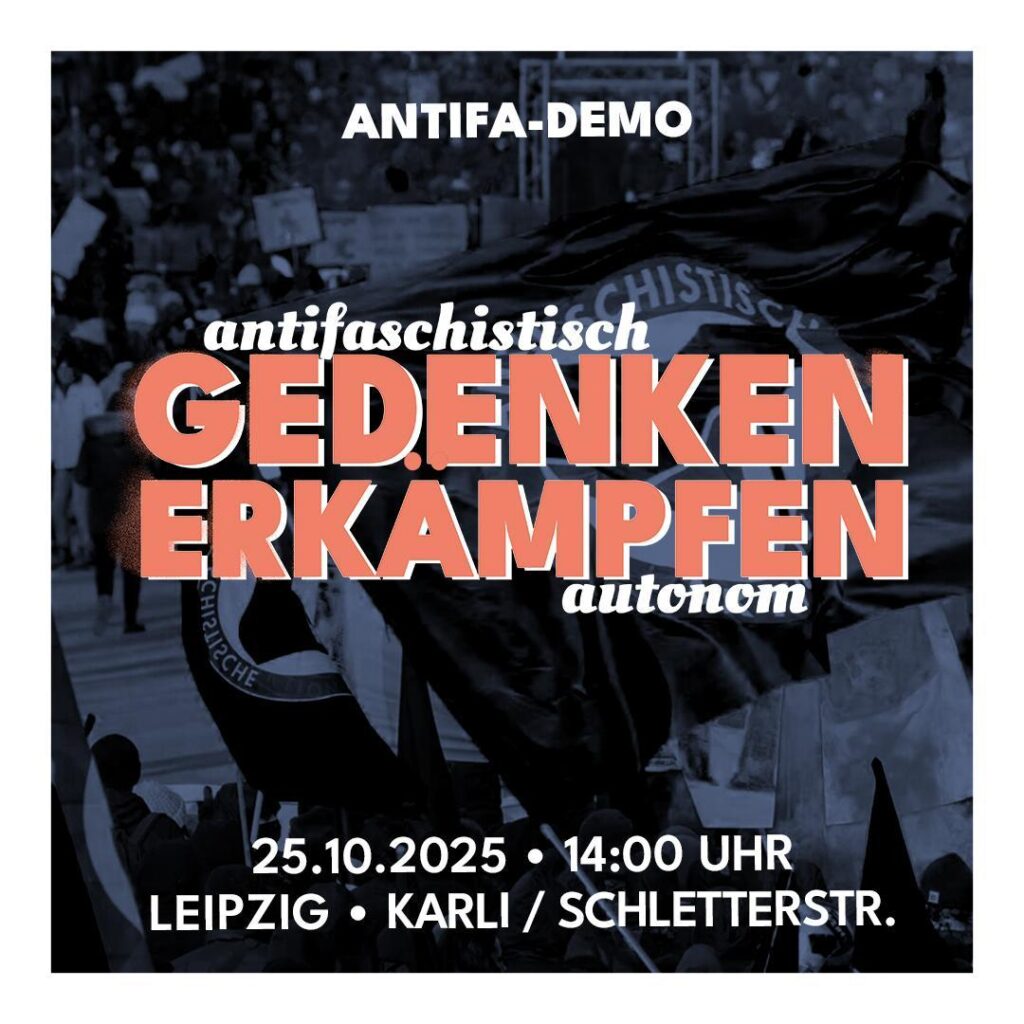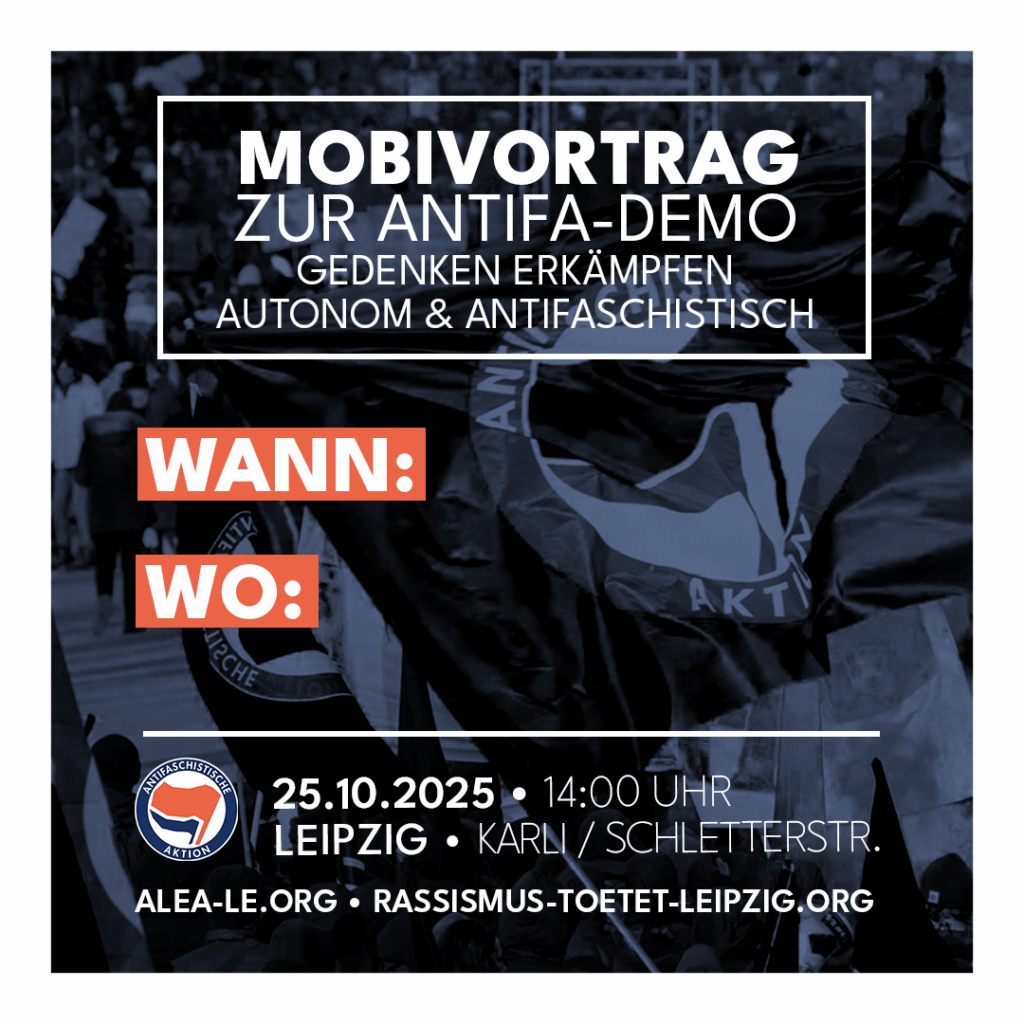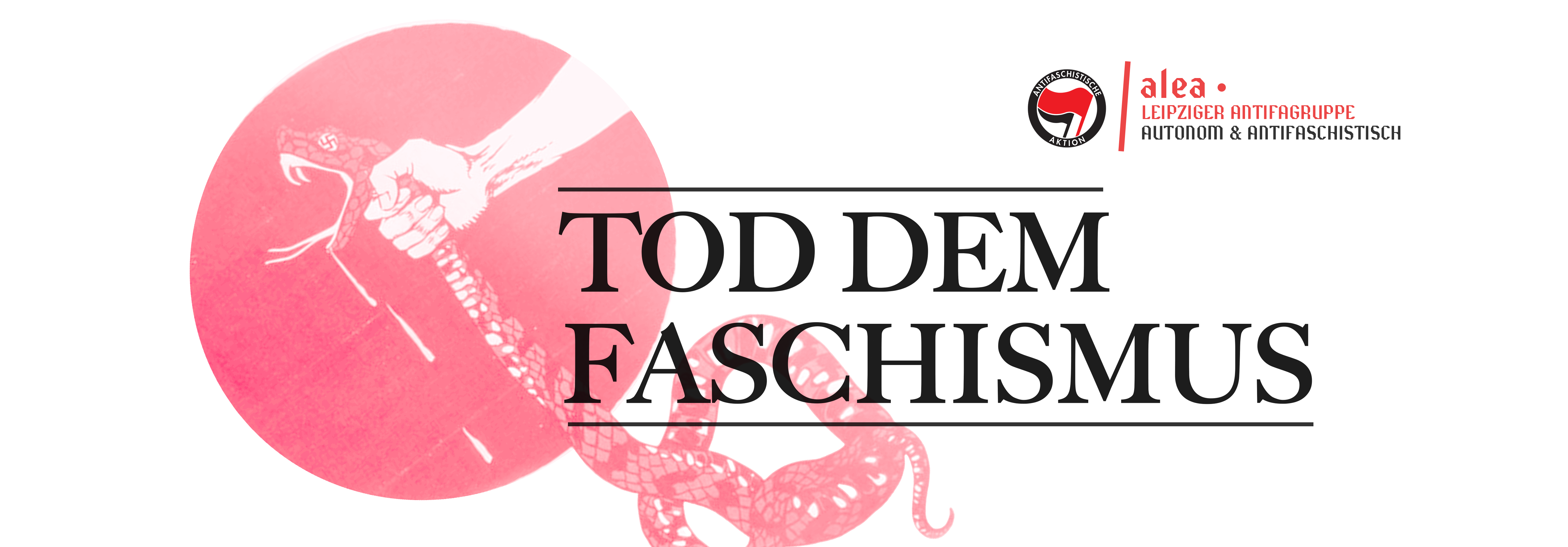“Gedenken erkämpfen – Autonom, Antifaschistisch!”
Ten more years of anger and sorrow
In den letzten 15 Jahren haben wir versucht, ein kritisches und antifaschistisches Erinnern an den rassistischen Mord an Kamal K., aber auch die anderen rechten Morde in Leipzig zu etablieren, ihre gesellschaftlichen Ursachen aufzuarbeiten und uns gegen eine rassistische gesellschaftliche Kontinuität zu stellen. Daran hat sich in den letzten 10 Jahren nichts geändert. Bereits vor 10 Jahren zur Gedenkdemo 2015 stellten wir fest:
“Leipzig tötet!”
“Kamal K., Horst K. und Gerhard Helmut B. sind lediglich drei von mindestens zehn Todesopfern – Gerhard S., Klaus R., Achmed B., Bernd G., Nuno L., Thomas K., Karl-Heinz T. – rechter Gewalt seit 1990 in Leipzig. Alle wurden aufgrund von rassistischen, sozialdarwinistischen oder homosexuellenfeindlichen Einstellungen der Täter ermordet. An sie und alle anderen Todesopfer sowie Betroffenen rechter Gewalt wollen wir mit dieser Demonstration erinnern. Die dauerhafte Auseinandersetzung mit den Morden ist notwendig, sind diese doch lediglich ein Spiegelbild gesellschaftlicher Zustände, jener also, die solche Morde erst möglich machen. Es ist die Akzeptanz und die Anerkennung von Aussagen und Meinungen die gegen Menschen gerichtet sind, die nicht den deutschen Norm- und Wertvorstellungen – weiß, heterosexuell, besitzend, lohnarbeitend – entsprechen und somit abgewertet werden.”
Auch zehn Jahre später hat das Morden in Deutschland kein Ende. In München, Halle, Hanau, Kassel, Solingen und vielen weiteren Orten in Deutschland wurden seit unserem Aufruf im Jahr 2015 Menschen aus rechten Motiven ermordet. Noch nicht benannt sind damit die unzähligen Betroffenen rechter Gewalt, die Bedrohten, die Verletzten und die Angehörigen, die zwar mit dem Leben davongekommen sind, deren Leben durch die Taten aber oft schwerwiegend beeinträchtigt bleibt.
Rassismus und andere menschenverachtenden Einstellungen werden nicht erst dann wirkmächtig, wenn Täter*innen morden. 859 rechte Angriffe dokumentierte die Opferberatung RAA im Zeitraum von 2009 – 2024 alleine in der Stadt Leipzig. Auch bei rechten Morden muss, wie bei allen rechten Gewalttaten, davon ausgegangen werden, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist.
“Sachsen tötet! Deutschland auch!”
Christopher W., Ruth K., André K., Marwa el-Sherbini, Bernd S., Patrick T., Peter T., Mike Z., Waltraud S., Jorge Gomondai, Günter T., Christa G., Michael G., Mario L. und laut dem Historiker Harry Waibel gibt es vier weitere namentlich unbekannte Todesopfer rechter Gewalt, seit 1990 in Sachsen. Der rechtsmotivierte Mord an Christopher W. wurde dieses Jahr von Seiten des sächsischen Innenministeriums sogar nachträglich aus der Statistik zu Todesopfern rechter Gewalt entfernt. Seit Jahrzehnten wird rechte Gewalt in Sachsen und Deutschland verharmlost und vertuscht.
Unsere Aussage zu Rassismus und neonazistisches Denken von 2015 wollen wir korrigieren. Damals schrieben wir:
“Das Reden über Rassismus und Rassist*innen scheint vorwiegend ein Reden über etwas Vergangenes zu sein. Zumeist wird Rassismus mit dem Nationalsozialismus sowie mit neonazistischen Denken in Verbindung gebracht. Dies verkennt jedoch die Dimension rassistischer sowie generell menschenverachtender Einstellungen und kann als eine Ursache für das Nicht (An-)Erkennen rechter Gewalt angesehen werden, was in der Aufarbeitung des NSU-Komplexes deutlich wird.”
Heute sind wir der Meinung: Das Reden über Rassismus scheint nicht mehr über etwas Vergangenes zu sein. Rechte und neonazistische Einstellungen sind gesellschaftsfähiger, jede*r kann sie offenkundig vertreten und inzwischen ist die öffentliche Aufregung darüber gering. Neonazis, AfD und fast alle etablierten Parteien haben sich untereinander verständigt, dass “die Migration” das Problem sei. Unterschiede gibt es lediglich formelle, wie “das Problem” gelöst werden soll. Das rechte Narrativ vom “Fremden” und “undeutschen” als Feind hat sich in der Mehrheitsgesellschaft durchgesetzt und Menschen, die einen vermeintlichen Migrationshintergrund haben, wird immer noch abgesprochen, Teil dieser Gesellschaft zu sein.
Die Entwicklung der letzten Monate und Jahre gerade in Sachsen zeigt, wie sehr aus dem rhetorischen Kampf, wiederum Realpolitik entsteht. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer fordert bereits seit längerem einen Kurswechsel im Umgang mit den “Themen” der AfD und der Partei an sich. Erst dieses Jahr erklärte er, es sei notwendig “die Realitäten in unserem Land anzuerkennen und wahrzunehmen, was die Mehrheit der Menschen einfordert von der Politik – allem voran beim Thema Migration”.
Geleugnet wird dabei stets, dass diese eingeforderte rassistische Politik eben nicht einfach so aufgekommen ist, weder erst mit der Gründung der AfD, noch ist sie einfach vom Himmel gefallen. Die fortschreitende Radikalisierung autoritärer und menschenfeindlicher Ansichten hat sich in der gesamten politischen Landschaft im Freistaat und auch auf Bundesebene bemerkbar gemacht. Grenzkontrollen, Abschiebungen, rassistische Narrative und Racial Profiling sind schon lange keine Praxen mehr, die für politischen Aufruhr sorgen.
Diese – die deutschen – Zustände töten. Sie töten außerhalb des eigenen Staatsgebietes, indem sie Menschen den räumlichen Zugang zu Sicherheit vor Krieg und Armut verweigern. Sie töten an den europäischen Außengrenzen, wo sie mit Frontex mitverantwortlich für Push-Backs und massenhaftes Ertrinken im Mittelmeer sind. Und sie töten hier, in Deutschland, in Sachsen, in Leipzig durch konkrete Individuen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, “Volk” und “Vaterland” bis aufs Blut zu verteidigen. Dass es das Blut derer ist, die sie als “anders” begreifen, versteht sich von selbst und sie können sich als legitime Vollstrecker des Volkswillens der schweigenden Mehrheit und AfD-Wähler*innen fühlen.
“Die Mauer fiel uns auf den Kopf” – Iman al Nassre und Diane Izabiliza
Ein Blick auf die Dokumentation rechter Übergriffe zeigt, dass es sich dabei nicht um ein neueres Phänomen handelt, sondern dass sich diese Entwicklung seit den 1990er-Jahren hinzieht. Der Mauerfall und die ihn umgebenden Narrative ließen eine wichtige Komponente außen vor: Das Rassismus und rechte Gewalt Motoren der deutschen Wende waren. Sie trugen zum Entstehen einer militanten Neonaziszene in Gesamtdeutschland bei, die schließlich zur Gründung von Neonazi- Terrororganisationen wie dem “Nationalsozialistischen Untergrund” (NSU) führten. Grundlage hierfür ist die Fortexistenz nationalsozialistischer Ideologiefragmente – sowohl in Ost-, als auch in Westdeutschland – sowie die sogenannte Wiedervereinigung, die wie ein Fanal auf die rechte Szene wirkte. Die Wende brachte die Möglichkeit, deutsche Geschichte neu zuschreiben. Auf einmal war “man wieder wer”, man war “ein Volk”.
Und in Leipzig, dem selbsternannten Nabel der “Wiedervereinigung” erst recht. Durch die Beschwörung eines demokratischen und antidiktatorischen Aufstands im Jahr 1989 wurde ein Mythos geschaffen, der dem nationalen Kollektiv einen positiven Bezug auf Deutschland ermöglichen soll. Die Zelebrierung einer quasi zweiten – aber diesmal durchweg positiv besetzten – Geburt der Berliner Republik geht mit der rhetorischen Gleichsetzung von DDR und Nationalsozialismus einher. Die Deutschen werden dadurch nicht nur zu bloßen Opfern zweier Diktaturen stilisiert, vielmehr gelingt es ihnen, sich von der Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus weiter zu lösen.
So wird die Erzählung von einem geläuterten Deutschland, das die Lehren aus der Geschichte gezogen habe und nun als eine bessere Nation mit unbeschwertem Selbstbewusstsein auftreten kann, aufs Neue bekräftigt. In der vollzogenen Geschichtsglättung gibt es selbstverständlich keinen Platz für widersprüchliche oder gar negative Aspekte, die dem konstruierten Selbstbild entgegen stehen. Stimmen von Betroffenen und jenen, die eben keinen Platz im nationalen Kollektiv haben, werden nicht gehört.
Eine an Stärke gewinnende Rechte konnte sich so als Vollstreckter des Volkswillen verstehen und in den Asylrechtsverschärfungen nach Pogromen in Deutschland, wie in Rostock-Lichtenhagen gaben Staat und Gesellschaft ihnen Recht. In diesem Rahmen werden der brutale Anstieg von Antisemitismus und Rassismus nach der “Wiedervereinigung” und die bis heute existenten menschenverachtenden Einstellungen in der Bevölkerung konsequent verschwiegen.
“Was möchte die Staatsanwaltschaft sehen, damit sie sicher ist, dass Kamal das Opfer eines geplanten, rassistischen Mordes geworden ist?” – Kamals Mutter
Seit dem militärischen Sieg der Alliierten über den Nationalsozialismus im Jahr 1945 sind in den postnationalsozialistischen deutschen Staaten über 400 Menschen Opfer rechter Gewalt geworden. Die Fälle rechter Gewalt sind so verschieden wie die Lebensrealitäten der Betroffenen – und doch eine gemeinsame Erfahrung: Ihre Geschichten wurden verdrängt, verharmlost oder ganz vergessen.
Lassen sich staatliche Akteur*innen dazu herab, über rechte Morde zu sprechen, werden die konkreten Grundüberzeugungen, die sie bedingen, in der Regel nicht benannt. Wenn rassistische, sozialdarwinistische oder auch homosexuellenfeindliche Taten nicht als solche benannt werden, wenn nicht klar gemacht wird, dass Personengruppen gezielt als Opfer ausgewählt werden, der auch ein Großteil der Bevölkerung feindlich gegenüberstehen, dann werden die Hintergründe verleugnet und die Verstrickung der Gesellschaft in die Taten verschleiert.
Rechte Gewalt ist eben keine Gewalt, die sich gegen “uns alle” richtet, das ist eigentlich auch allen bewusst. Sie ist immer auch eine Botschaftstat an die, die vermeintlich nicht dazugehören, die aus dem deutschen Kollektiv ausgeschlossen werden. Deshalb wird sich nicht mit ihren Bedingungen befasst, deshalb wird sie nicht verhindert. Für den Staat und die Dominanzgesellschaft gibt es kein eigenes Interesse, sich damit zu befassen. Sie sind nicht betroffen. Im Gegenteil: Sie tragen weiterhin zum Bestehen dieser menschenfeindlichen Strukturen bei.
Während wir in Leipzig von zehn Todesopfern rechter Gewalt und einem weiteren Verdachtsfall ausgehen, erkennt der deutsche Staat nur Kamal K., Achmed B., Nuno L. und Thomas K. als solche an. In Deutschland sind es oftmals die Hinterbliebenen, die um die Anerkennung ihrer ermordeten Angehörigen und gegen das Vergessen kämpfen. Ohne ihre unerbittliche Arbeit – das beharrliche Erinnern, das Sammeln von Beweisen, das öffentliche Sichtbarmachen der Taten – wären viele dieser Morde längst im Dunkeln der Geschichte verschwunden.
Der gesellschaftliche und staatliche Unwille zur Auseinandersetzung und Aufarbeitung zeigt sich auch in der Art, der Opfer zu gedenken. Während die Stadt Leipzig jährlich Kränze zum sogenannten Volkstrauertag niederlegt, fanden die Opfer rechter Gewalt selten Eingang ins städtische Bild. Lange gab es keine Tafeln oder anderweitige Gestaltung von Gedenkorten, um ihrer zu erinnern. Die heute an den Tatorten vorzufindenden Denkmäler entstanden durch Initiative von Betroffenen und Hinterbliebenen, wurden von solidarischen Menschen unterstützt und mussten oft staatlichen Institutionen abgerungen werden.
Die offizielle Erinnerung wird zur Bühne der Selbstinszenierung: Reden, Kränze, mahnende Worte – alles mit dem Ziel, die eigene moralische Integrität zu demonstrieren. Ein Beispiel davon war 2024 in Gaschwitz beim Gedenken an Nuno L. zu erleben. Hier hielt der Bürgermeister von Markkleeberg nach einem Projekttag mit Schüler*innen eine Rede in der es mehr um die gesellschaftliche Entwicklungen und möglichen Wahlen in den USA ging als um den rechten Mord in Gaschwitz. Nicht darum, dass die Täter von damals noch heute in der Region leben. Nicht darum, wie sich die Gesellschaft in Sachsen entwickelt und die AfD zu jenem Zeitpunkt davor Stand, die Landtagswahl in Sachsen zu gewinnen.
Ein solch selektives Gedenken – mangelnde Sichtbarkeit im städtischen Raum sowie fehlende Aufarbeitung rechter Strukturen und gesellschaftlicher Verhältnisse, aber Erinnern, wenn es das städtische Image verlangt – instrumentalisiert Gedenken auf illegitime Weise. Dabei geht es nicht um die Betroffenen, nicht um die Hinterbliebenen, nicht darum zu verhindern, dass sich solche Taten wiederholen. Es geht lediglich um ein geläutertes Image der Stadt. Aus solchem Gedenken folgt nichts.
“Deutschland und Stadt Hanau schulden mir ein Leben.” – Emis Gürbüz
Nach einem jahrelangen Kampf ist nun ein Dokumentationszentrum zum NSU “Offener Prozess” in Chemnitz eröffnet worden. Dort können die rassistischen Ermittlungsansätze, die Verstrickungen der Behörden und auch der Kampf der Angehörigen um Anerkennung sehr gut nachvollzogen werden. Ein Besuch ist unbedingt empfehlenswert.
Trotzdem kann man sich fragen, ob durch eine solche Institutionalisierung von Gedenken – der Staat als Geldgeber – der widerspenstige Stachel gezogen wird. Selbst im neuen Koalitionsvertrag hat man sich darüber verständigt, dass ein neues NSU-Dokumentationszentrum entstehen soll. Söder hat sich höchstpersönlich dafür eingesetzt, dass es nach Nürnberg kommt. Die Beauftragte kann also verlauten: “Das ist für Nürnberg jetzt eine Riesenchance und ich glaube, das haben wir auch verdient, weil wir so viel Vorarbeit geleistet haben.” Die CSU hat es sich redlich verdient, eine neue Touristenattraktion in Söders Heimatstadt!
Oder eben wie im Fall Emis Gürbüz, die einen Eklat auf der diesjährigen Gedenkveranstaltung in Hanau ausgelöst hat, da sie wagte, Kritik an Staat und Stadt zu üben. Jetzt soll ein solches Gedenken laut der Stadt Hanau so nicht mehr stattfinden. Gedenken ja, aber bitte ohne Kritik der Angehörigen an staatlichen Institutionen.
Doch nicht nur der Staat instrumentalisiert. Immer wieder kann beobachtet werden, dass bestimmte Strömungen der radikalen Linken sich dem Gedenken aus instrumentellen Gründen widmen, die es bisher nicht getan haben. Hierbei negieren sie häufig die zentralen Bestandteile, die Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Sexismus und Homosexuellenfeindlichkeit für die Struktur der Gesellschaft, in der wir leben, haben.
Sie werden zu Nebenwidersprüchen delegiert, die nach ihrer “Revolution” nicht mehr von Belangen seien und somit eine dezidierte Auseinandersetzung mit den Hintergründen rechter Gewalt verunmöglicht. Es wird sich des eigenen Standpunktes selbst vergewissert, indem Ermordete zu “Märtyrer*innen” einer Klasse stilisiert werden, die “im Kampf für unsere Sache gefallen” seien. Die eigene “Kampfesbereitschaft” wird immer wieder betont, auch wenn man weder die Begrifflichkeiten, noch die Theorie oder die Praxis hat – oder überhaupt haben will – um sich der tödlichen Gewalt entgegen stellen zu können.
Gedenken autonom, antifaschistisch
Es muss also ein autonomes, antifaschistisches Gedenken geben. Aber warum überhaupt Gedenken? Gedenken bedeutet Unversöhnlichkeit mit der Geschichte. Es richtet den Blick nicht auf das, was gesiegt hat, sondern auf das, was gescheitert ist. Eine antifaschistische Bewegung braucht ein historisches Bewusstsein, das aus der Vergangenheit heraus in der Gegenwart für die Zukunft kämpft.
Was heute allzu oft als Erinnerungskultur inszeniert wird, verdient diesen Namen nicht. Es handelt sich vielfach um ein entkerntes, staatstragendes Gedenken, dessen Hauptzweck nicht die Aufarbeitung, sondern die Selbstvergewisserung ist. Solches Gedenken ist illegitim, weil es die Ursachen der Verbrechen systematisch entpolitisiert, ihre Fortdauer leugnet und das eigene Kollektiv reinwaschen will. Es schützt nicht vor Wiederholung, es bereitet sie vor.
Die offizielle Erinnerung wird zur Bühne der Selbstinszenierung: Reden, Kränze, mahnende Worte – alles mit dem Ziel, die eigene moralische Integrität zu demonstrieren. Wo Gedenken zur rituellen Pflichtübung verkommt, die Schuld delegiert und gesellschaftliche Verantwortung verschleiert, dient es nicht der Wahrheit, sondern der Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes – individuell wie kollektiv.
Warum aber hat dieses Gedenken Erfolg? Weil es bequem ist. Weil es die narzisstischen Bedürfnisse einer Gesellschaft bedient, die sich als geläutert feiern will, ohne sich tatsächlich zu verändern. Gedenken ist nicht neutral – es ist ein politischer Akt. Und wer bestimmt, wie erinnert wird, bestimmt auch, was gesagt wird, was vergessen werden darf. Politische Interessen erfordern ein stabiles nationales Narrativ – selbst wenn das heißt, Neonazismus zu relativieren, institutionellen Rassismus zu leugnen oder die Rolle staatlicher Strukturen bei historischen Verbrechen zu verharmlosen. Besonders in Deutschland gehört zum Staatsgedächtnis auch die Inszenierung der Bewältigung – eine Art moralischer Schlussstrich, der jede tiefere Infragestellung des Kollektivs abwehrt.
Kritisches Gedenken jedoch muss genau das Gegenteil tun, nur so kann Solidarität entstehen. Gedenken, das sich den Verstorbenen wirklich verpflichtet fühlt, muss sowohl die unaufgearbeiteten Strukturen ins Visier nehmen, die das Unrecht erst möglich machten, als auch die eigenen, viel zu bequemen und oft blinden Verstrickungen in den fortbestehenden Status quo erkennen. Wer sich nicht selbst in die Schuldzusammenhänge begreift, kann auch nicht kritisch Gedenken. Kritisches Gedenken ist Selbstverunsicherung und Selbstkritik des Eigenen. Nur durch einen radikalen Bruch mit der Inszenierung, dem ewigen Gedächtnistheater kommen wir dem einen Schritt näher – durch Bildung, Aufklärung und Protest. Alles andere ist Verdrängung mit Blumenstrauß.
“Die Gewalt kam damals zu uns” – Nanuk
Über viele Jahre hinweg galt insbesondere Leipzig als “liberale linke Insel” im ansonsten braunen Freistaat Sachsen, wo gesellschaftskritisches Engagement möglich war, ohne gleich am nächsten Morgen von Cops mit Waffen im Anschlag aus dem Bett gezerrt zu werden – wie es z.B. erst kürzlich dem Hausprojekt Hospi30 in Görlitz wegen antifaschistischer Plakate widerfahren ist. Dies ist allerspätestens in Leipzig mit dem Antifa Ost – Verfahren und der gegründeten SoKo LinX vorbei. Aus unserer Sicht sind diese Entwicklungen einer immer reaktionäreren Politik, Formen sozialer Verhärtung und einer weiteren Aufrüstung im Inneren. Der besonders in Sachsen geführte Kampf gegen den sogenannten Extremismus ist eine Kampfansage an die gesellschaftskritische Opposition und die Vorbereitung, eben jene nicht von rechts kommende, endgültig zum Schweigen zu bringen.
Die Einteilung in “guten” und “bösen” Antifaschismus – einen staatskonformen und einen konsequenten autonomen – wird in Sachsen seit jeher vorgenommen und überrascht uns keineswegs. Emanzipatorische, linke und antifaschistische Politik musste in Sachsen seit jeher erst aufgebaut, Freiräume erkämpft und dann immer wieder verteidigt werden – nicht nur gegen Neonazis oder staatliche Repression. Antifaschistisch aktiv zu sein, war kein Hobby sondern Lebensrealität.
Die Praxis richtete sich auch gegen die lokale Bevölkerung. So antwortete die antifaschistische Gruppe Erfurt dem Antifa Kalender auf die Frage “Seht ihr euch als spezifisch ostdeutsche Antifas und was folgt daraus?” wie folgt:
“Wir brauchen wirklich niemandem hier die spezifische Kontinuität nazistischer Gewalt im Osten erklären – der NSU konnte hier folgerichtig gedeihen. In Ostdeutschland aktiv zu sein heißt, dass man recht schnell erkennt, dass man den Kampf für die befreite Gesellschaft nicht mit, sondern gegen »das Volk« organisieren muss. D.h. also antifaschistische Arbeit richtet sich hier gegen die Masse der Bevölkerung, die sich zwischen Gleichgültigkeit, klammheimlicher Freude und aktivem Zuspruch für eine autoritär-faschistische Entwicklung zeigt. Wenn also irgendwo irgendwelche Roten die Masse des Volkes adressieren, wird man generell und im Speziellen in Ostdeutschland entweder scheitern oder den MaKssDamage machen müssen. Weil es sich bei dieser Masse des Volkes nämlich um ein Mordkollektiv im Wartezustand handelt, bringen die Worte unserer Südthüringer Genoss*innen die Notwendigkeit negatorischer, antagonistischer Politik auf den Punkt: »Dieser Antifaschismus ist antideutsch, oder er hat seinen Gegenstand nicht begriffen. Wenn das spezifisch ostdeutsch ist, dann nehmen wir uns dessen an.«”
Auch wir stellen fest, dass die Perspektiven der Antifaschist*innen, die in der DDR geboren und im post-sozialistischen Osten aufgewachsen sind, sich bis heute nur selten in Strategiedebatten der westdeutschen Antifa wieder findet, wie der “Zeit zu Handeln” – Aufruf gezeigt hat. Eine ostdeutsche Sozialisation, der politische Umbruch und die allgegenwärtige Präsenz von Neonazis und die permanente rechte Gewalt passen nicht so recht zu den K-Gruppen und anderen Spaltungslinien einer westdeutschen Linken. Die Geschichte und der Eigencharakter der ostdeutschen Antifaschist*innen scheinen bis heute nur wenig anschlussfähig zu sein. Bis auf die Gruselgeschichten, wie Anfang der Neunzigerjahre besetzte Häuser gegen Neonaziangriffe verteidigt werden mussten, mangelt es auch weiterhin am Interesse an einer ostspezifischen Bewegungsperspektive.
Wir sind weit davon entfernt, Antworten oder neue Strategien auf die gesellschaftlichen Entwicklungen zu haben; und was wir in der Rückschau auf die Ereignisse in Leipzig nach dem Urteil im Antifa Ost – Verfahren gar nicht empfehlen können, ist, sich im aktuellen Zustand linker Bewegung in Leipzig und dem Rest des Landes auf eine offene Auseinandersetzung mit dem Staat einzulassen. Wir denken, es braucht vielmehr wieder eine Diskussion über die Bedingungen linker Politik und Organisierung, die auch die unterschiedlichen lokalen Bedingungen in den Blick nimmt.
Agieren autonom, antifaschistisch
In einem solchen gesellschaftlichen Klima entstehen Initiativen, Gruppen und Bewegungen, die sich gegen diese Zustände organisieren. Antirassismus und Antifaschismus sind keine ideologischen Sonderpositionen, sondern notwendige Reaktionen auf reale Bedrohungen.
Die Morde des NSU, von Hanau, Halle, München und so viele mehr, der kontinuierliche Aufbau rechter Netzwerke in Polizei und Bundeswehr, aber auch alltägliche rassistische Gewalt machen deutlich: Es braucht Menschen, die sich diesen Entwicklungen in den Weg stellen – öffentlich, kollektiv, entschlossen, militant. Dabei geht es nicht nur um Symbolik oder Demonstrationen, sondern auch um praktische Solidarität, um Schutzräume und um konkrete Interventionen gegen rechte Strukturen.
Ein autonomes, antifaschistisches Gedenken ist mehr als nur das Erinnern an vergangene Verbrechen. Es ist eine aktive, kritische Praxis, die sich gegen die Verharmlosung, Instrumentalisierung und das Vergessen stellt. Doch um wirklich etwas zu verändern, reicht es nicht, nur in Gedanken dabei zu sein oder auf Institutionen zu vertrauen. Es ist notwendig, sich autonom antifaschistisch zu organisieren – jenseits von Ritualen und eines allgemeinen Habitus. Nur durch eigenständiges Agieren, durch direkte Interventionen und solidarisches Eingreifen können wir den rechten Strukturen entgegentreten.
Dieses Agieren muss eine Haltung sein, die sich nicht mit oberflächlichen Ritualen zufriedengibt, sondern tief in der Gesellschaft ansetzt. Es bedeutet, die eigenen Verstrickungen zu reflektieren, Machtverhältnisse zu hinterfragen und sich gegen staatliche und gesellschaftliche Vereinnahmungen zu stellen. In der Praxis heißt das: Wir müssen aktiv gegen rechte Strukturen vorgehen, sie sichtbar machen und ihnen entgegenstehen. Das bedeutet, sich selbst zu organisieren, ohne autoritäre Top- down-Strukturen, unabhängig von staatlichen Vorgaben und gemeinsam für eine antifaschistische Praxis einzustehen. Es ist Zeit, die Hände aus dem Schoß zu nehmen.
Hier könnten wir die inhaltslosen Durchhalte-Parolen wiederholen, die zu jeder Zeit und an jedem Ort gedroschen werden. Das war uns dann aber doch zu doof.
Nicht willkommen auf der Demo sind national und territorial Fahnen und dergleichen Symbole jedweder coleur, sowie Fahnen von Parteien und anderen politischen Organisationen. Es sollte nicht um die jeweilige (pol.) Identität gehen, sondern den Anlass. Wir wollen nicht als politische Plattform von Gruppen und deren Themen instrumentalisiert werden. Die antifaschistische Aktion sollte uns als Ausdruck genügen.