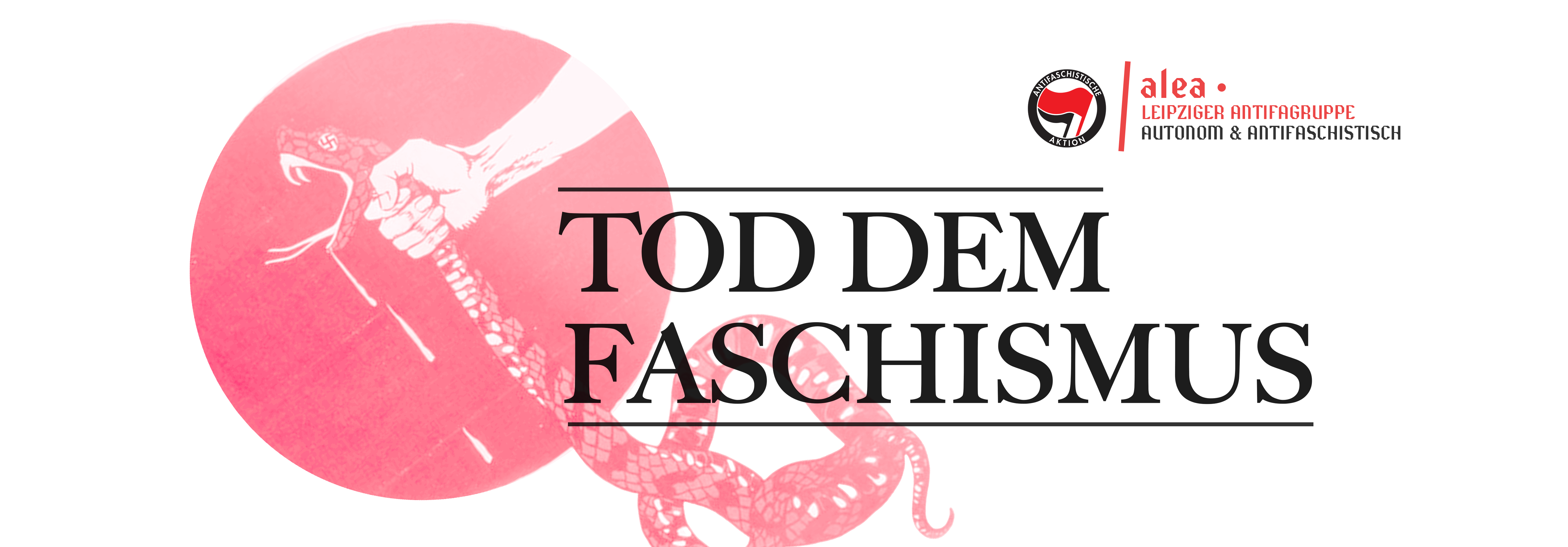Redebeitrag von alea zum 9.11.
Redebeitrag von alea gehalten am 9. November 2025 auf der Kundgebung im Gedenken an das Novemberpogrom 1938
„Die Menschen haben Angst. Auch ich habe Angst“, sagte Max Privorozki, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, vor zwei Wochen während einer Podiumsdiskussion. Er rät inzwischen davon ab, auf offener Straße eine Kippa zu tragen, und zweifelt daran, dass die jüdische Gemeinde in Halle, oder überhaupt in Europa, noch eine Zukunft habe. Er spricht von einer „unvorstellbaren antisemitischen Welle“, die sich seit dem 7. Oktober entfaltet habe und nicht abzuebben scheine. „In Europa riecht es wieder nach Rauch. Es ist der Rauch eines alten Feuers, das nie ganz erloschen ist.“
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden in ganz Deutschland Jüdinnen und Juden angegriffen, misshandelt und getötet. Feuer und Rauch stiegen auf, als am frühen Morgen des 10. November in Leipzig zivil gekleidete SA-Männer mit Benzinkanistern die Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße, die Ez-Chaim-Synagoge, das Kaufhaus Bamberger & Hertz, die Höhere Israelitische Schule, den jüdischen Friedhof und dessen Trauerhallen aufsuchten und diese Einrichtungen in Brand setzten. Die Pogrome waren kein Ausdruck eines spontanen Volkszorns, wie die NSDAP es darzustellen versuchte. Goebbels hatte die SA und SS zwar angewiesen, in Zivil zu agieren, doch viele folgten dieser Anweisung nicht. Seine Hoffnung, eine breite „Volksbewegung“ gegen die jüdische Bevölkerung auszulösen, erfüllte sich nicht vollständig; dennoch beteiligten sich zahlreiche Zivilisten an den Plünderungen, zerrten ihre jüdischen Nachbarn aus den Wohnungen und gaben ihrem Hass freien Lauf. „Juden heraus!“, „Raus, ihr Judenschweine!“ hallte es durch die Straßen. Ein Großteil der Deutschen wohnte den Demütigungen der Juden als Schaulustige bei. Die Täter schändeten alles Wertvolle, was sie finden konnten, und verbrannten es auf offener Straße. Zurück blieben verkohlte Mauern, Asche und Rauch.
Bereits im April 1933, wenige Monate nach der Machtübernahme durch die NSDAP, wurden Gesetze gegen Jüdinnen und Juden verabschiedet, mit der Intention, dass möglichst viele von ihnen das Land verlassen sollten. Das sogenannte „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ sollte den Ausschluss der Juden aus dem Staatsdienst bewirken. Ärzte, Lehrer und andere Berufe mit Beamtenstatus durften nur noch von NSDAP-Unterstützern ausgeübt werden. Da rund 80 % der Medien unter der Kontrolle der Nationalsozialisten standen, konnte die antisemitische Propaganda besonders intensiv betrieben werden und ein Boykott gegen jüdische Geschäfte verbreitete sich rasch. Diese wurden als „jüdisch“ markiert, ihre Besitzer bedroht und angegriffen, falls sie es doch wagten, ihre Läden zu öffnen. Auch nichtjüdische Menschen erlitten Repressionen, wenn sie sich dem Boykott nicht fügten. Dem Großteil der jüdischen Bevölkerung wurde dadurch die finanzielle Existenzgrundlage entzogen. Die von den Nationalsozialisten erhoffte umfassende Emigration blieb aus, da nur wenige über die Mittel verfügten, sich im Ausland ein neues Leben aufzubauen. Die antijüdische Politik verschärfte sich zunehmend.
Als der jüdische Emigrant Herschel Grynszpan am 7. November 1938 auf einen Diplomaten an der deutschen Botschaft in Paris schoss, nahmen die Nationalsozialisten die Tat zum Vorwand, um Pogrome zu initiieren. Die Novemberpogrome markieren eine Zäsur von der alltäglichen Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung seit 1933 hin zu ihrer systematischen Vertreibung, Demütigung und Vernichtung durch den NS-Staat.
In Leipzig wurden in dieser Nacht um die 200 Geschäfte, 34 Privathäuser, drei Synagogen, vier kleinere Gebetsräume, die Friedhofskapelle und das Ariowitsch-Altersheim zerstört. Hunderte jüdische Schaufenster wurden eingeschlagen, Wohnungen geplündert und verwüstet. Ein Junge wurde aus dem Fenster seiner Wohnung gestoßen; er brach sich beide Beine, als er auf die Straße fiel, auf der die brennenden Überreste seines Zuhauses loderten. Insgesamt wurden in dieser Nacht 552 jüdische Männer durch SA, Gestapo und SS verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. Menschen wurden gezielt verprügelt und ermordet, einige begingen Suizid. Die Feuerwehr erhielt den Befehl, nicht einzugreifen, solange keine benachbarten Gebäude vom Feuer bedroht waren.
In den folgenden Tagen kam es zu weiteren Verhaftungen und Deportationen, vor allem von jüdischen Männern. In Deutschland wurden rund 30.000 Jüdinnen und Juden in Konzentrationslager verschleppt. Hunderte starben an den Haftbedingungen oder wurden ermordet. Viele Leipziger Jüdinnen und Juden flohen aus der Stadt.
Unmittelbar nach den Novemberpogromen befürwortete Hermann Göring die Einrichtung von Ghettos für Juden. Diese Idee wurde jedoch verworfen, da die Überwachung als zu schwierig galt. Stattdessen wurden sogenannte „Judenhäuser“ angeordnet, in denen die aus ihren Wohnungen vertriebenen Menschen zusammengepfercht leben mussten. Oftmals waren diese Unterkünfte nicht zum Bewohnen geeignet, sondern provisorisch errichtete Orte wie ehemalige Schulen, Büros oder Friedhofshallen.
Lebten 1938 noch etwa 12.000 Juden in Leipzig, so waren es nach dem Krieg nur noch 340. In den folgenden Jahrzehnten wuchs die jüdische Gemeinde durch die Zuwanderung der sogenannten Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion langsam wieder an.
Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in der Karl-Heine-Straße 43, wurde eine jüdische Familie vertrieben. Dort befand sich einst das Kaufhaus der Familie Joske. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlor die Familie ihre wirtschaftliche Existenz, da die Kundschaft ausblieb. Vater Hans Joske musste das Geschäft schließen und versuchte fortan, als reisender Kaufmann den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu sichern.
Aus Polizeiakten geht hervor, dass Hans Joske im März 1939 gerade noch die Flucht nach Frankreich gelang. Seine Familie musste er zurücklassen, da es an Geld fehlte, um seine Frau und Kinder nachzuholen. Mit Beginn des Krieges war eine Auswanderung nicht mehr möglich. Seine Frau Clara Joske wohnte zuletzt in einem „Judenhaus“ in der Jacobstraße. 1942 wurde sie gemeinsam mit ihrem jüngsten Kind Ruth nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Hans Joske wurde in Frankreich in zwei verschiedenen Lagern interniert, die er überlebte. Er lebte bis zu seinem Tod 1948 in Frankreich und sah seine Familie nie wieder. Die ältere Tochter Hilde Joske konnte kurz vor Kriegsbeginn mit einem Kindertransport nach Schweden fliehen und entging so der Vernichtung. Zwei Jahre später emigrierte sie nach Israel, gründete dort eine Familie und verstarb 1993. Der älteste Sohn Hellmut Joske verließ Deutschland bereits 1936 und gelangte nach Palästina. Dort ließ er sich zum Bücherrevisor ausbilden und leistete zwischen 1948 und 1950 seinen Militärdienst in Israel. Er verstarb als Gideon Bar-Joseph im Jahr 2016.
Der moderne Antisemitismus ist kein Relikt der Vergangenheit, sondern ein tief verwurzeltes gesellschaftliches Problem, das auf einem der ältesten sozialen, kulturellen und politischen Ressentiments beruht. Schon im frühen Christentum entstand der Antijudaismus und lieferte den Nährboden für Verschwörungserzählungen, die bis heute wirken. Wie schon Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung schreiben: „Antisemitismus ist ein eingeschliffenes Schema, ja ein Ritual der Zivilisation, und die Pogrome sind die wahren Ritualmorde.“
Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 haben Gewalttaten gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland stark zugenommen. Große Teile der Linken betreibt eine Täter-Opfer-Umkehr und rechtfertigt die Taten der Hamas nach dem Motto: „Wer Wind sät, wird Sturm ernten.“ Nicht die Täter seien verantwortlich, nein, es seien „die Israelis”, deren angebliche Macht und Präsenz die Wut auf sich ziehe. Die Gräueltaten der Nationalsozialisten werden dabei zunehmend mit der israelischen Politik der letzten Jahre gleichgesetzt und die Hamas als eine antikoloniale Widerstandsbewegung gefeiert.
Vermeintliche „Israelkritik“ unterscheidet jedoch selten zwischen dem Staat Israel und der israelischen Regierung. Israel wird als kollektives Symbol allen Juden zugeschrieben, während der sogenannte „Kollektivjude“ den individuellen Juden ersetzt. Dabei stellt der Staat Israel nach der Schoa den einzigen Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden dar.
Die Befürwortung und Unterstützung von Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, die Relativierung der Schoah und die positive Bezugnahme auf das Massaker der Hamas vom 7.Oktober sind zur Normalität geworden. Für Jüdinnen und Juden in Deutschland bedeutet das: soziale Isolation, Ausgrenzung und Rückzug aus dem öffentlichen Leben. So wird jüdisches Leben in Europa 87 Jahre nach den Novemberpogromen wieder zunehmend unsichtbar.