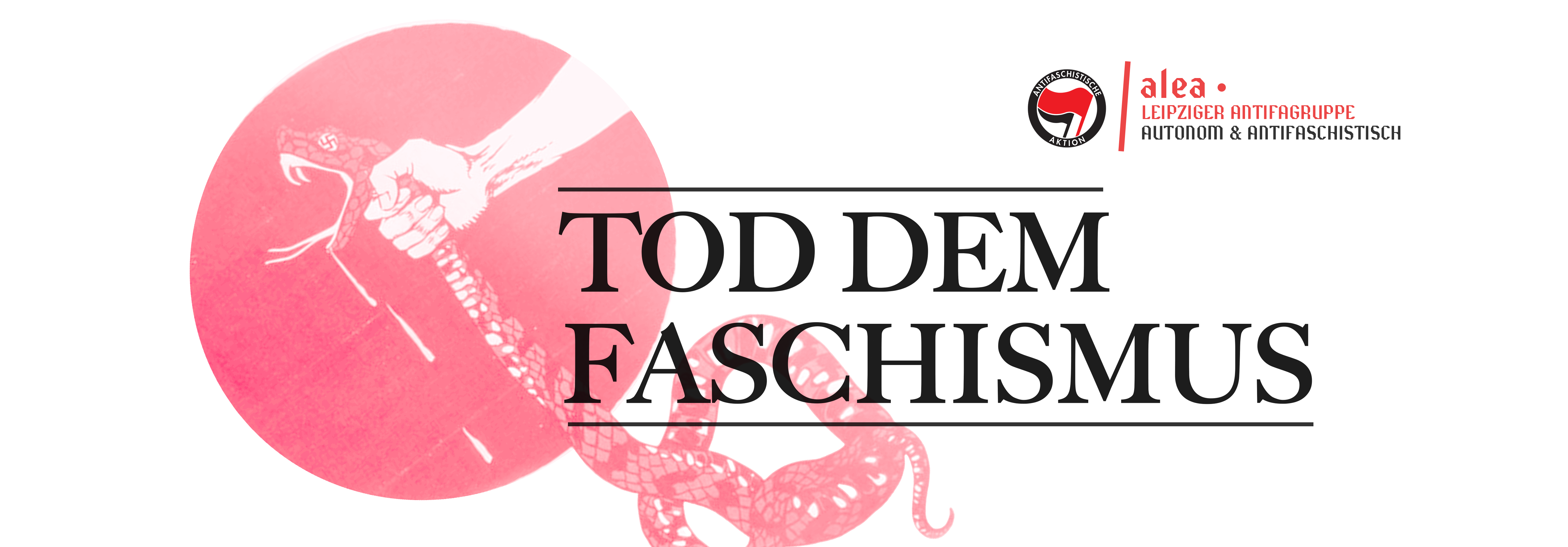Redebeitrag von disput zum 9.11.
Redebeitrag von disput gehalten am 9. November 2025 auf der Kundgebung im Gedenken an das Novemberpogrom 1938
Wir stehen hier und wollen erinnern. Wir wollen etwas erinnern, dessen Teil wir noch immer sind, dessen Grundlage fortbesteht. Deshalb muss auch daran erinnert werden, dass es anders möglich ist, denn ein historisches Erinnern, welches nur Geschehenes sortiert und chronologisch anordnet, muss bewusstlos bleiben, fixiert auf das Bestehende. Es trennt auf, was zusammengehört, verzichtet auf Reflexion und setzt an die Stelle Bescheidwissen. Wer alles weiß, muss nicht mehr darüber nachdenken. Dadurch wird verdrängt, was als Kontinuum gegenwärtig ist, die Herrschaft von Staat und Kapital. Deshalb ist es noch immer so, wie Hannah Arendt es einst schrieb: „Vor Antisemitismus ist man nur noch auf dem Monde sicher.“
Ganz gewiss jedenfalls nicht in Europa, dazu ließen sich nach dem Sommer zahlreiche Beispiele an dieser Stelle ausführen, und eine Chronik der Gewalt gegen Juden und Jüdinnen ist dann dokumentiert, die darauf verweist, dass die Möglichkeit von Auschwitz in diesen Verhältnissen fortwest. Das müsste genügen, um verständlich zu machen, dass überhaupt die Frage aufzuwerfen, ob Israel nicht auch Mitschuld am 07.10. trägt, antisemitisch ist. Diese Mitschuld ist dann meist schon durch die schlichte Existenz begründet. Stattdessen müssen alle wieder über Israel diskutieren, ganz vorneweg selbstverständlich die westliche Linke, wobei Diskutieren als Bezeichnung eigentlich nicht zutrifft. In den meisten Staaten ist die Linke bereits wieder bei ihrer schlimmsten Angewohnheit angekommen: personifizierter Antikapitalismus, der das Böse aus der Welt schaffen will, welches das Gute, das Echte korrumpiert und verschlingt. Das steigert sich zunehmend ins Wahnhafte, entbindet vom Denken und lässt wissen, wo das Böse zu verorten ist. Dabei ist die Frontstellung gegen den Schutzraum aller Juden und Jüdinnen ein Versuch, die materialisierte Erinnerung an das, was den gesellschaftlichen Verhältnissen mit dem NS entsprungen ist, zu tilgen. Diese Erinnerung ist das Anliegen, welches uns hier heute zusammenkommen lassen hat.
Will dieses Gedenken mehr sein als ein schlichtes Wissen, welches sich durch die Distanz der vergangenen Zeit zu dem Geschehenen von einem abgespalten werden kann und keine Verantwortung mehr empfunden wird, muss es um die Kritik des Antisemitismus heute und die durch Selbstüberhöhung verdeckte Nichtigkeit des eigenen Politikmachens gehen.
Eine unüberschaubare Zahl an Büchern und Texten wurde verfasst, um den Versuch zu unternehmen, begreifbar zu machen, dass in einer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft Antisemitismus und die damit einhergehende Tendenz der Vernichtung um ihrer selbst willen einerseits möglich gewesen ist und zum deutschen Staatsprogramm erhoben wurde und andererseits auch mit dem Eintreten des Schlimmsten kein Ende gefunden hat und nach wie vor Juden und Jüdinnen sich nirgends auf der Welt wirklich sicher fühlen können. So dringend die Bewusstseinsbildung über die Dynamiken des Antisemitismus ist, fällt aber auch häufig dabei die notwendige Verbindung zur Irrationalität der Verhältnisse aus der Kritik heraus. Antisemitismus lässt sich nicht als gesonderte Erscheinung kritisieren, ohne die Herrschaft von Kapital und Staat abschaffen zu wollen. Ansonsten verkommt es zur akademischen Spielerei, die eher dem eigenen Fortkommen in eben diesem Betrieb dient. Damit ist die Auseinandersetzung dann in der Funktion wohl nicht mehr allzu verschieden zu der Entlastung, die Antisemitismus den Subjekten bereitstellt. Es wird davon entlastet, einen Umgang damit zu finden, dass man tagtäglich selbst an der Reproduktion des Ganzen und damit an den Zwängen, der Permanenz des Leids beteiligt ist. In diesem Sinne kann die massenhafte Hinwendung zur Entlastung durch Antisemitismus als Seismograph der Krisenhaftigkeit der Totalität bezeichnet werden. Vernichtung um ihrer selbst willen nimmt als Möglichkeit wieder schärfere Konturen an. Dass der Einzelne dem sich zuwendet, ist nicht zu begreifen, es lässt sich nur durch Kritik auf die Abschaffung des Zwangszusammenhangs drängen, der die Bedingung der Möglichkeit dazu schafft. Meist ist allerdings wohl nicht mehr möglich, als der Hoffnung darauf einen Ort der Erinnerung zu geben. Daran zu erinnern, dass die Einheit der Vielen ohne Zwang möglich ist.
Im geschichtslosen Voranschreiten der Katastrophe zeigt sich explizit die sogenannte radikale Linke als williger Vollstrecker der Tendenz des Ganzen. Im Selbstverständnis die Bewegung, welche doch für die Verbesserung, ja Rettung der Welt eintritt. In diesem moralischen Appell versteckt sich bereits eine Sehnsucht nach dem Echten, dem Organischen, dem Authentischen, wie es sich heute nur allzu häufig in Antisemitismus und Gemeinschaftssehnsucht ausdrückt. Nur zu gerne wird sich selbst als Opfer inszeniert, dafür mit den Leuten in Gaza identifiziert und dabei meist dann nicht mehr als die eigene Verzweiflung artikuliert.
Nun lässt sich sagen – und das würde ich als eines der wenigen Dinge, an denen Zweifel nicht dem Gegenstand gemäß ist, bestimmen –, dass dies Ausdruck vollkommener Geschichtslosigkeit und Wahn ist und ganz gewiss nicht das, was mit selbstzufriedenem Lächeln, hervorgebracht durch den Glauben, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, voller Stolz als Befreiung der Menschheit ausgegeben wird. Befreiung mit Vernichtung um ihrer selbst willen gleichzusetzen, das sollte Erinnerungen hervorrufen, aber auf eine Linke wird es vergeblich sein zu hoffen. Diese bezieht sich entweder zunehmend wieder auf ein Denken, welches vor der Shoah nicht dazu in der Lage gewesen ist, den eigenen heiligen Gral, das Proletariat, dagegen in Stellung zu bringen, oder auf ein Denken, welches sich ohne Hehl auf Heidegger und Schmitt bezieht, die als Denker des NS diesen mit ins Werk gesetzt haben. Unerkannt bleibt dabei das eigene Mitwirken, dass das einzelne leibliche Individuum zum Exemplar degradiert wird, als welches es dem Tod preisgegeben werden kann; ob dies der eigene oder der der anderen, der ausgemachten Feinde ist, kann dabei verschwimmen oder wird im Märtyrerkult bejaht.
Dazwischen wird eine Linke zerrieben, die einst im Sinne einer sogenannten antideutschen Kritik dem etwas entgegensetzte und heute relativ verzweifelt versucht, sich selbst als Überbleibsel dieser Kritik von der Bezeichnung als Antideutsch abzugrenzen, als sei dies eine Jugendsünde. Vielleicht ist es das Bangen um die eigene Bündnis- und Anschlussfähigkeit, die dazu treibt, dem Vorwurf, antideutsch zu sein, zu entfliehen.
Die Abwehr der Bezeichnung ist vielleicht auch Ausdruck einer Selbstüberhöhung, man denkt, dass man darüber hinaus sei, das war mal, aber nun … ja was nun? Was kann eine Kritik der Gesellschaft sein, die über die Antideutsche hinaus ist, diese in sich aufgehoben hat? Es könnte eine Kritik auf der Höhe der Zeit sein, doch davon ist weit und breit nichts zu vernehmen. Stattdessen sieht man sich genötigt, nahezu passiv zu registrieren, dass die eigene Kritik vielleicht noch für szeneinterne Debatten hinreichend ist, aber meistens auch das eher, um im eigenen Umfeld seinen Standpunkt nochmal hervorzukehren und für sich zu werben. Aufgerüttelt wird wohl niemand mehr dadurch.
Denn der Stand der Kritik ist ein ziemlich erbärmlicher, und um sich noch irgendwie auf ein Gemeinsames zu beziehen, welches einen verbindet, in Abgrenzung zu den ganzen neuen linken Dienern der Klasse und der Völker, werden dann solche Bezeichnungen wie „antiautoritär“ oder „israelsolidarisch“ bemüht. Was das genau bedeuten soll, scheint niemand so genau zu wissen. Hauptsache von den „Roten“, wie es so gerne heißt, abgrenzen. So sehr eben diese in stereotypes Denken verfallen, wenn sie das Feindbild der Antideutschen beschwören, ist man selbst auch nicht weit davon entfernt, in der eigenen Hilflosigkeit.
Der Wunsch, irgendwie anschlussfähige Politik machen zu wollen, verkommt zur Spiegelfechterei. Dabei zeigt sich dann, dass die Abgrenzung von der Bezeichnung Antideutsch keine Aufhebung, sondern ein Rückfall ist. Bewusstlos für den Zusammenhang von Staat und Kapital wird sich in das Handgemenge gestürzt. Dieser Drang zum Machen, so nachvollziehbar es ist, sich von dem Gefühl, dass irgendetwas doch richtig zu machen sein muss, antreiben zu lassen, verdrängt dabei das einzige Engagement, welches einem im gegenwärtigen Stand der Unfreiheit auferlegt ist: die Parteinahme für Israel.
Was lässt sich sagen, um dem einen Ausdruck zu verleihen, der sich nicht in Phrasen von Kitsch und Propaganda verfängt? So bleibt auch mir nichts, als Vergangenes wieder hervorzuholen: Israel bis zum Kommunismus.
Das Ende Israels ist das Ende dieser Hoffnung. Deshalb gilt dem Schutzraum aller Juden und Jüdinnen die bedingungslose Solidarität.
Erinnern muss auch ein Erinnern an die Möglichkeit des Kommunismus sein, denn wenn nicht in der Hinzunahme dieser Hoffnung erinnert wird, ist verloren, dass irgendwann aufzuhören vermag, was diese Erinnerung notwendig gemacht hat: die Herrschaft von Staat und Kapital.