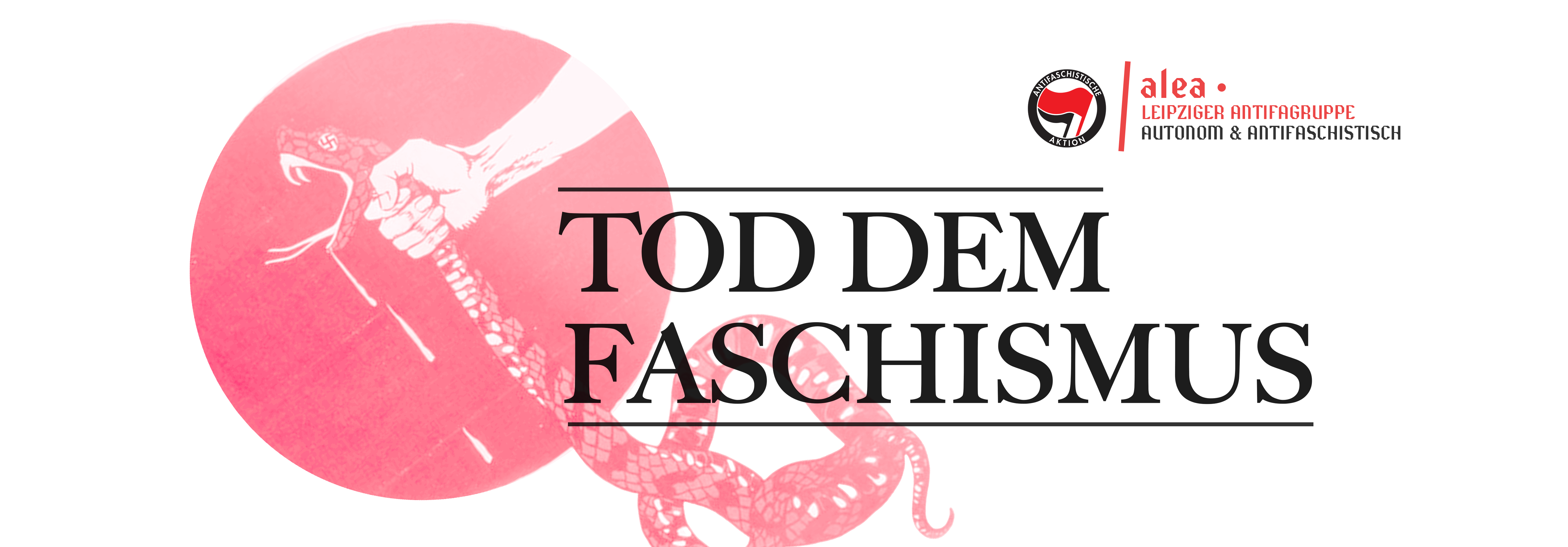Redebeitrag einer Genossin aus der translib zum 9.11.
Redebeitrag einer Genossin aus der translib gehalten am 9. November 2025 auf der Kundgebung im Gedenken an das Novemberpogrom 1938
Wir treffen uns heute hier, um der Opfer der Novemberpogrome zu gedenken. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 griffen Nazis deutschlandweit Synagogen, Einrichtungen der jüdischen Gemeinden, jüdische Geschäfte und Wohnhäuser an, verschleppten Jüdinnen und Juden in KZs, folterten und töteten sie.
Die Pogrome geschahen nicht im luftleeren Raum. Sie markierten den Umschlag der nationalsozialistischen Politik von Diskriminierung zu Verfolgung. Bereits ab 1933 waren weitreichende Maßnahmen durchgesetzt worden, um Juden die Existenzgrundlage zu entziehen und sie so aus Deutschland zu vertreiben. Die Nazis setzten zunächst Boykotts jüdischer Geschäfte, den Ausschluss jüdischer Beamten aus dem Staatsdienst, den Verlust der Zulassung für jüdische Anwälte, das Verbot jüdischer Ärzte Kassenpatienten zu behandeln und eine Quotierung jüdischer Schüler:innen und Studierenden an Schulen und Unis durch. 1935 wurden dann die Nürnberger Rassegesetze beschlossen, die Jüdinnen und Juden den Bürgerstatus aberkannten und Ehen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Personen verboten. Die Infrastruktur für weitere Gewaltakte war also bereits etabliert. Jüdische Geschäfte waren bereits als solche markiert. Jüdischen Personen war ihre ökonomische Grundlage zu großen Teilen bereits entzogen worden, ebenso wie der rechtliche Status, sich gegen Unrecht zur Wehr setzen zu können.
Die staatlichen Angriffe auf das jüdische Leben waren in Leipzig massiv und besonders sichtbar. Die Stadt hatte vor dem NS eine der größten jüdischen Gemeinden Deutschlands. Aufgrund der Messe war Leipzig ohnehin attraktiv und zog wegen der frühen rechtlichen Liberalisierung Jüdinnen und Juden an. Die Liberalisierung und die Größe der Gemeinde ermöglichten die Etablierung jüdischer Institutionen, die wiederum mehr jüdische Menschen in die Stadt zogen. Die sechstgrößte Gemeinde Deutschlands machte mit ca. 11.500 Mitgliedern knapp 2 % der Leipziger Gesamtbevölkerung aus. Sie prägte mit zahlreichen Institutionen das Stadtbild. Dementsprechend fiel der schrittweise Ausschluss der Jüdinnen und Juden aus dem Leben der Stadt deutlich auf.
In der Nacht vom 9. auf den 10. November eskalierte die nationalsozialistische Regierung die antisemitische Gewalt. Sie befahl systematische Anschläge auf jüdische Glaubensstätten, Kauf- und Wohnhäuser. Sie versuchte, die Pogrome wenig überzeugend als Volksaufbegehren auszugeben. Die Bevölkerung – so die offizielle Erzählung – rächte sich an den Juden für das Attentat, dass der deutsche Jude Herschel Grynszpan wenige Tage zuvor in Paris auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath begangen hatte. Beobachtern war jedoch klar, dass es sich keineswegs um spontane Ausschreitungen handelte, sondern um einen staatlich orchestrierten Gewaltakt. Einen Gewaltakt, der allerdings vom weitaus größten Teil der Bevölkerung mindestens geduldet, wenn nicht gar befürwortet wurde. Die Details der Geschehnisse sind für Leipzig gut dokumentiert. Es wird darauf verzichtet, sie hier erneut darzustellen. Es sei nur eines bemerkt: die Zerstörung der Leipziger jüdischen Gemeinde war umfassend. Hatten 1933 noch 11.500 Juden in Leipzig gelebt, so traf die amerikanische Armee bei ihrer Ankunft in der Stadt im Jahr 1945 nur noch 15 an.
Diskriminierung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden durch den Staat sind in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Seit dem 7. Oktober 2023 ist die Zahl antisemitischer Straftaten allerdings blitzartig in die Höhe geschossen. Eigentlich ein Anlass, um sich verstärkt darum zu bemühen, jüdische Menschen vor Gewalt zu schützen. Und während in Deutschland seither nahezu obsessiv über Antisemitismus diskutiert wird, ist der Schutz jüdischen Lebens in diesen Diskussionen häufig allenfalls ein sekundäres Anliegen.
Deutschen Politikern ist zuerst an einem gelegen: zu zeigen, wie toll die Vergangenheit aufgearbeitet wurde. Wir erleben insbesondere seitens der Merz CDU einen Diskurs, in dem Antisemitismus als Problem muslimischer Personen mit Flucht- oder Migrationshintergrund geframt wird. Mit dieser Unterstellung wird zweierlei geleistet. Einerseits lässt sich damit eine Verschärfung der Abschiebepolitik rechtfertigen. Andererseits entlässt man die Deutschen ohne Migrationshintergrund aus der Verantwortung. Antisemitismus: gibt’s in Deutschland nur noch als Importware. Damit werden aber Jüdinnen und Juden auch zum Gesicht dieser Abschiebepolitik gemacht. Eine Minderheit wird gegen die andere ausgespielt.
Ein weiteres Negativbeispiel im Umgang mit Antisemitismus ist die Linkspartei. Im ersten Parteitag nach der Wahl bespricht sie erstmal, welche Antisemitismusdefinition sie für richtig hält. Allerdings ging es in dieser Debatte nicht darum, ein linkes Programm zu erarbeiten, das den Schutz jüdischen Lebens zum Ziel hat. Es ging vielmehr darum, sich vom Vorwurf des Antisemitismus frei zu machen. Der Knackpunkt in der Diskussion sind Israelkritik und der in der Partei weit verbreitete Antizionismus. Anliegen der Linken ist es, sich möglichst uneingeschränkt kritisch über Israel äußern zu können. Während Kritik zunächst auf ein wechselseitiges Anerkennungsverhältnis hindeutet und erstmal nichts Verwerfliches ist, übt die Linke an keinem Staat so beharrlich und besessen Kritik wie an Israel. Auf dem Parteitag einigte sich die Partei per Mehrheitsbeschluss auf die Antisemitismusdefinition der Jerusalemer Erklärung. Sie wies damit die Definition der International Holocaust Rememberance Alliance kurz IHRA zurück. Die Definition der IHRA bringt allerdings Antisemitismus und Israelkritik in einen viel stärkeren Zusammenhang. Es handelt sich hier um nichts anderes als eine akademisierte „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ Diskussion.
Es wird viel über Antisemitismus geredet. Verhandelt wird dabei aber selten der Schutz jüdischer Menschen vor Gewalt. Die Frage nach Israel – und damit auch nach der Existenz eines staatlich zugesicherten Gewaltschutz von Jüdinnen und Juden – hat sich zur Gretchenfrage der Moderne entwickelt. Antisemitismus und damit im Zusammenhang stehende Debatten über Israel und Israelkritik fungieren zurzeit wieder als kultureller Code, anhand dessen Menschen sich zu den politischen Fragen der Gegenwart verorten.
Während nicht-jüdische Menschen in der Diskussion um Antisemitismus damit beschäftigt sind, ihre politische Heimat zu markieren, nimmt die antisemitische Gewalt zu. Am 7. Oktober dieses Jahres feierten Personen in Berlin den Jahrestag des Terroranschlags der Hamas auf Israel. Im selben Monat wurde ein Fotograf, der Bilder von einer antiisraelischen Demo machte, mit der Begründung, dass er Jude sei, bewusstlos geschlagen. Im September wurde ein Paar in einer Berliner U-Bahn körperlich angegriffen, als sie bejahten, Juden zu sein. Am selben Tag wurden Fußballspieler des deutsch-jüdischen Fußballvereins TuS Makkabi Köln antisemitisch beleidigt und körperlich angegriffen. Allein seit September meldet die Amadeu-Antonio-Stiftung vier Vorfälle in denen Gegenstände mit Hakenkreuzen markiert wurden1. Im Jahr 2024 ist die Zahl polizeilich erfasster antisemitischer Straftaten im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen. Die Zahl der Gewaltdelikte hat sich gegenüber 2022 beinahe verdoppelt2. Viele jüdische Studierende trauen sich nicht mehr an ihre Hochschule und immer weniger Jüdinnen und Juden geben sich in der Öffentlichkeit als solche zu erkennen.
An dieser Gewalt zeigt sich, dass Antisemitismus weitaus mehr ist, als nur kultureller Code. Jüdinnen und Juden oder wahlweise auch Israel als jüdischer Staat werden zum Symbol all dessen gemacht, was an der Moderne verhasst ist. Der von vielen Antizionist:innen verhasste Staat Israel repräsentiert in ihrer Vorstellung die abstrakt gewordene, nationalstaatliche Kolonialherrschaft schlechthin. Jüdinnen und Juden verkörpern in der Fantasie der Antisemit:innen nach wie vor eine kapitalistisch organisierte Gesellschaft, die die Menschen zum Überleben in Lohnarbeitsverhältnisse zwingt. Dieser Hass wird an seinem Gegenstand aber nie Befriedigung finden, weshalb auch da, wo er vergleichsweise harmlos daherkommt, immer das Risiko schlummert, dass sich aus Abneigung Vernichtungsfantasien und aus Vernichtungsfantasien konkrete Pläne zur Umsetzung dieser Fantasien entwickeln. Daher ist auch dieser 9. November nicht bloß ein Gedenken, sondern auch eine Mahnung, dass es weiterhin gilt, dafür zu sorgen, dass die Vergangenheit sich nicht wiederholt.
1 Vgl. https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/chronik/
2 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/829792/umfrage/polizeilich-erfasste-antisemitische-delikte-in-deutschland/