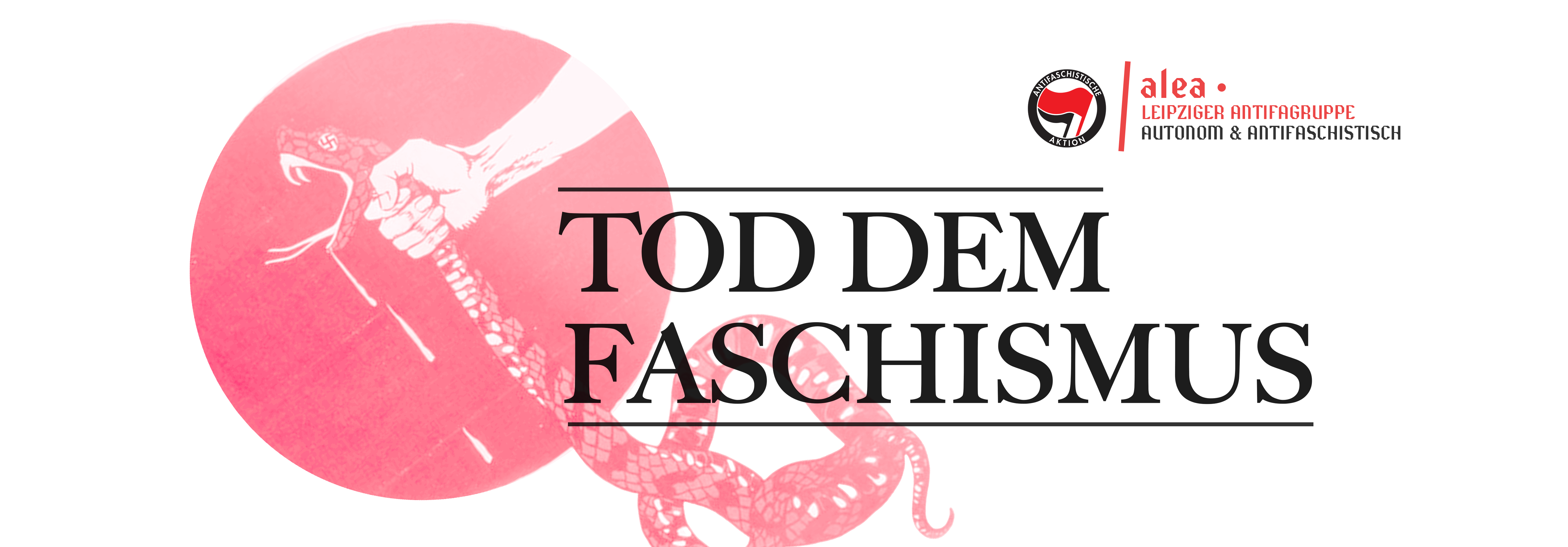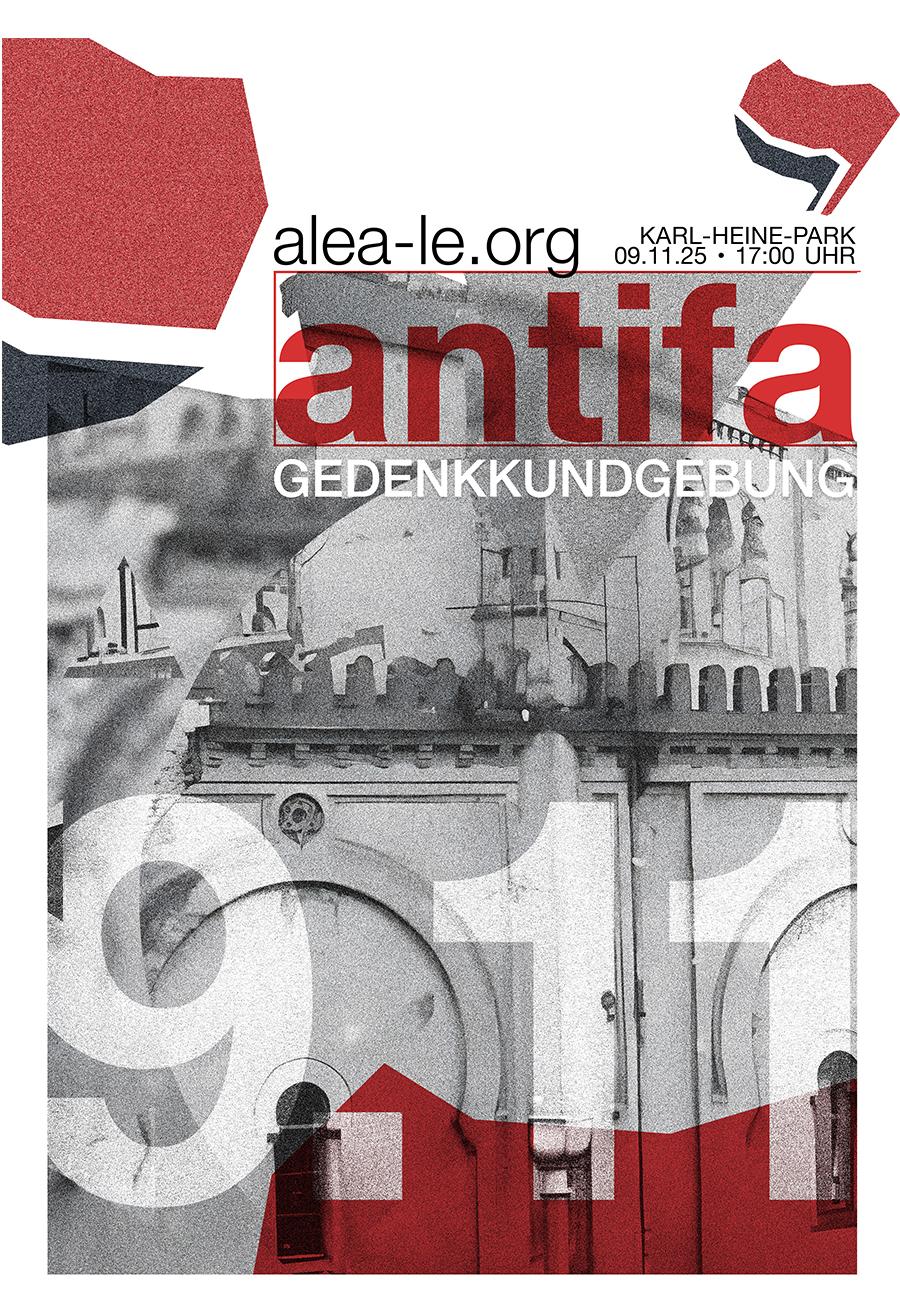Antifa-Gedenkkundgebung zum 09.11.2025
Am 9. November jährt sich zum 87. Mal die Pogromnacht. Sie steht für den Beginn der offenen und durch nichts mehr gehemmten Hatz auf die Jüdinnen:Juden. Die Nazis ermordeten zwischen 1000 und 2000 Jüdinnen:Juden, und zerstörten im ganzen Deutschen Reich 1400 Synagogen und Betstuben. Als „organisierten Volkszorn“ betitelten die Nazis ihr Werk, aber das war es nicht; es war ein staatlich organisierter Angriff, dem viele weitere folgten, und dessen Motiv in der ab 1941 einsetzenden organisierten Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Europas seinen finalen Ausdruck fand.
Eine dazu passende Stimmung freilich hatte sich in der Bevölkerung bereits zuvor festgesetzt, und so wurde die Ausgrenzung und Ermordung der Jüdinnen:Juden schulterzuckend hingenommen, teils begrüßt und nicht selten aktiv an ihr teilgenommen. Sie waren schon keine Mitbürger:innen mehr, keine Nachbar:innen, um die sich zu scheren war, sie waren schon nur noch das „Unglück“, als die sie die NS-Zeitung der Stürmer in jeder Ausgabe bezeichnete. Und ein Abmetzeln des Unglücks, das war eben nur das: ein Kampf für das Glück.
Der Schrecken der Schoah wirkte lange nach, und wenngleich der Antisemitismus selten ganz verstanden wurde und vor allem nie ein Ende fand, so wurden Angriffe auf Jüdinnen:Juden dennoch mit einem gesellschaftlichen Tabu belegt. Ein Antisemit zu sein, das war etwas, was sich nur die veruchtesten unter den alten und neuen Anhängern des Nationalsozialismus über sich zu sagen trauten. Aber: Gerade weil das Verständnis des Antisemitismus gering blieb, war und ist eine ständige Erneuerung des Tabus bis heute nötig, um erneute Exzesse gegen Jüdinnen:Juden zu verhindern. Denn dass sie „unser Unglück“ sind, das glauben insgeheim immer noch viele, und diejenigen, die bereit sind, dies offen zu äußern, mehren sich. Es ist kein festes Tabu, es ist brüchig.
Es ist daher zweierlei zu tun: Zum einen ist das Erinnern wachzuhalten an das, was geschah, auf dass es in diesem Ausmaß nie wieder geschehe; es ist zum anderen das Wissen über Antisemitismus zu vergrößern und zu mehren. Denn: Die Menschlichkeit, die mit den Menschenrechten verteidigt werden soll, war noch nie; ihr ständiges Anrufen ist Phrase, nicht mehr; sie reicht nicht, um uns als Menschen vor dem zu bewahren, was anhaltend droht: entweder Opfer oder Monster zu werden.
Wir gedenken der Pogromnacht am 9. November um 17 Uhr am Karl-Heine-Platz in Plagwitz. Kommt dazu.