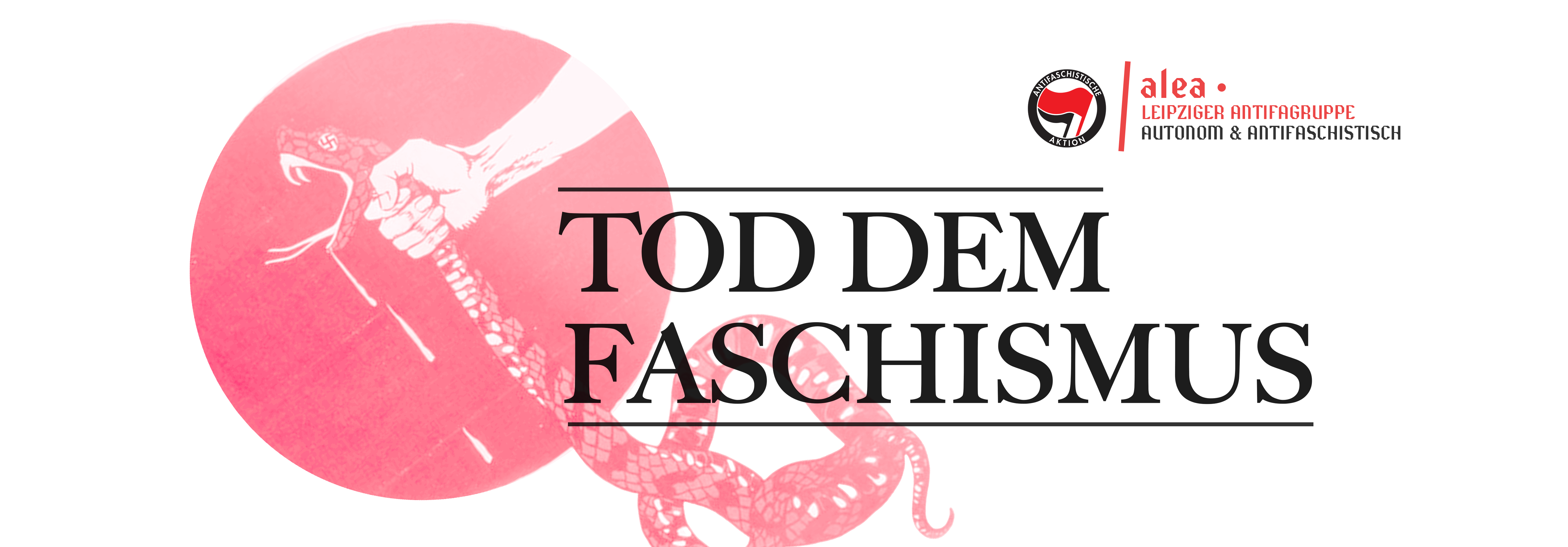Redebeitrag einiger Genossen von alea zum 9.11.
Redebeitrag einiger Genossen von alea gehalten am 9. November 2025 auf der Kundgebung im Gedenken an das Novemberpogrom 1938
1887 veröffentlichte Theodor Fritsch ein Buch. Es trug den wenig zweideutigen Titel: „Antisemiten Katechismus“ und war eine Sammlung von antisemitische Zitaten, Forderungen und Statistiken, Angaben über die Größe der jüdischen Gemeinden einzelner Städte, umstrittene Auszüge aus dem Talmud, und auch Tipps für Firmen und Geschäfte, wo man Produkte wie z. B. Apfelwein oder Olivenöl kaufen konnte, die nicht von Juden hergestellt worden waren. Theodor Fritsch war, wie viele seiner Gesinnungsgenossen stolz auf das was er tat; er war stolz darauf, ein Antisemit zu sein. Und ein Antisemit zu sein, dafür brauchte sich damals niemand zu schämen.
Fritsch gab sich in seinem Katechismus Mühe, den Antisemitismus abzugrenzen von anderen Feindseligkeiten gegen Juden. Wichtig war es ihm, klarzustellen, dass es um die Rasse, nicht aber die Religion ging. So schrieb er:
[W]enn die Antisemiten die Religion der Juden bekämpften, so müßten sie sich „Anti-Israeliten“ nennen . Es verräth also ein geringes Sprach-Verständniß, wenn Jemand den Antisemitismus mit der „Religion“ in Zusammenhang bringt.
Fritsch war es wichtig: Antisemit, das war jemand, der gegen die Juden aufgrund ihrer Rasse vorging, nicht aufgrund ihres Glaubens. Ein Antisemit, so dachte er, war eben auch ein Humanist, kein Barbar.
Es gab aber schon früh eine Tendenz, sich von einer positiven Besetzung des Begriffs zu entfernen. Die erste Distanzierung erfolgte dabei schon vor Fritsch`s Buchveröffentlichung, etwa als Eugen Dühring 1881 schrieb, man solle den Begriff vermeiden, weil der Eindruck erweckt würde, es ginge allgemein um Semiten, wo es doch nur um die Juden ging. Und im August 1935 forderte das Reichspropagandaministerium des NS-Regimes die Presse auf, auf den Begriff zu verzichten, weil „die deutsche Politik sich nur gegen die Juden, nicht aber gegen die Semiten schlechthin richtet. Es soll stattdessen das Wort: antijüdisch gebraucht werden.“ Die erste Kritik wurde also geübt, um Verwirrungen im Begriff zu beheben. Erst nach 1945 wurde der Begriff als Beschreibung aller Aspekte judenfeindlicher Ideologie, die den Holocaust ermöglicht, vorbereitet, begleitet und gerechtfertigt haben, genutzt.
Und heute? Heute ist niemand mehr Antisemit, abgesehen von ein paar Wenigen, die sich offen zum Nationalsozialismus bekennen. Ein Antisemit zu sein, dass hat nichts mehr mit Humanismus zu tun. Es ist ein Schimpf- und Schmähwort, und wen es trifft, der soll damit als reaktionärer Mensch der übelsten Sorte gebrandmarkt werden.
So ist es denn auch vielen, die heute gegen Israel und Israelis wettern, wichtig, klarzustellen, dass es nicht um die jüdische Religion, oder gar die jüdische Rasse geht. Nein, es geht um etwas anderes, es geht um den Kampf gegen etwas, das wirklich schlimm ist, etwas, das böse ist, etwas, was eigentlich das gleiche ist, wie der Faschismus, wenn es nicht sogar schlimmer ist. Es geht gegen: den Zionismus. Und es gibt eine anhaltende Anstrengung darum, denen, die von sich sagen, dass sie keine Antisemiten sind, sondern eben Antizionisten, nachzuweisen, dass sie eben doch Antisemiten sind. Dass sie sich und anderen etwas vormachen, und dass sie insgeheim angetrieben sind vom Hass auf die Juden. Und es wäre dann eine Aufgabe auch im Gedenken an die Schoah, hieran anzuknüpfen, an diesem Beweis mitzuwirken.
Der Vorwurf, dass Antizionisten und Israelhasser Antisemiten sind, wird erhoben von vielen. Er wird mittlerweile mehr von Rechten erhoben, als von Linken, und wer gerne etwas über Antizionisten, die in Wahrheit Antisemiten sind, lesen will, der kann das Bestens tun in der „Welt“, der „Bild“, oder bei einigen Instagram-Accounts der CDU.
Es fällt auf, dass der Vorwurf, ein Antisemit zu sein, bei denen, die er trifft, einfach abgelehnt wird. Es mag sie ärgern, dass sie so geschmäht und der üblen Sache verdächtigt werden, aber anstatt sich mit dem Vorwurf auseinanderzusetzen, wird er abgewehrt, häufig unter zur Hilfenahme von Juden, die sich selbst antizionistisch, sich selbst israelkritisch positionieren. Und auch das muss man anerkennen: Juden, die Israel hassen, die den Zionismus ebenfalls für so etwas wie den Faschismus halten, werden unter den Antizionisten nicht drangsaliert, sondern im Gegenteil: Sie werden präsentiert wie etwas Besonderes, wie ein Beweis für die Größe des eigenen Handelns. Ein Antizionist, dass ist eben kein Barbar; ein Antizionist, dass ist ein Humanist. Ein Antizionist ist gern Antizionist, und er wählt diesen Titel für sich selbst.
Es mag für manche reizvoll erscheinen, zu versuchen, denen, die sich einen edlen Titel wählen, einen schmutzigen Titel geben zu wollen. Es mag ja sogar gut und gerechtfertigt sein, den, der sich edel wähnt, in Wirklichkeit aber ein grausamer und kalter Mensch ist, die Wahrheit über sich zu vermitteln. Wenn dies sich aber auf einen Streit darüber, wie sich einer nennt, und wie man aber will, wie er anders zu nennen ist, äußert, dann führt das hin zu einer Auseinandersetzung über Diskurshoheit. Und in dieser mag man sich zwar gefallen, wenn man sie hat, und daran unglücklich sein, wenn man sie nicht hat, aber insgesamt kommt man eben in die unglückliche Allianz mit den Hassschreibern der Springerpresse und neofaschistischen Staatenlenkern wie Trump oder Meloni.
Überhaupt ist fraglich, was es bringen soll, aus einem Antizionisten oder aus einem Isrealhasser einen Antisemiten zu machen. Der Gewinn durchs veränderte Etikett taugt wenig. Er hilft nicht, etwas besser zu verstehen, und tatsächlich verdunkelt er ja auch das, was man eigentlich erklären will. Denn es macht einen Unterschied, ob jemand sich „Antisemit“ oder eben „Antizionist“ nennt. Um den Unterschied schließlich geht es: Es geht darum, dass ein Antisemit schlimmer ist als ein Antizionist, dass ein Judenhasser schlimmer ist als ein Israelhasser.
Die Entwicklung weg von Judenhass und hin zum klaren Antizionismus hat selbst die Hamas in einer Wende vollzogen, als sie 2017 in Bezug auf ihre Gründungscharta Abstand davon nahm, die Juden zu hassen, sondern nur gegen das zionistische Projekt zu kämpfen. Und trotzdem ist ihr Angriff vom 7. Oktober 2023 dadurch nicht weniger grausam, und er gewinnt an Grausamkeit auch nicht hinzu, wenn man festhält, dass er antisemitisch gewesen sei. Vielmehr zeigt sich ja, wozu die antizionistische Bewegung bereit ist, und zunehmend wird der Begriff „Zionist“ benutzt, um die Gegner und Feinde einer Befreiung „by any means neccesary“ zu bezeichnen. Niemand muss mehr wirklich Zionist sein, um diesen Titel zu erhalten, und längst ist er zum internationalen Schmäh- und Schimpftitel geworden.
Was aber genau ist gemeint, wenn die Freunde der durch nichts mehr gehemmten Befreiung vom gewaltvollen Zwang der bürgerlichen Welt, ihre Gegner als Zionisten beschimpfen, und zugleich darauf beharren, damit nicht die Juden zu meinen? Das ist es, was zu beantworten ist, wenn man sich mit der gegenwärtigen Lage befassen will, und die Antwort auf diese Frage ist wichtiger als der Streit darum, ob ein Antizionist auch noch ein Antisemit ist.
Denn hier hat ein Wechsel stattgefunden. Für den Antisemiten war der Jude schuld am ausufernden Zwang des gesellschaftlichen Prozesses, für all das Elend, dass dabei war, die Welt zu verschlingen. In dieser widersinnigen und wahnhaften Verzerrung der Welt ist der Mord an den Juden das subjektive Erleben des Kampfes um die Freiheit durch die Verwirklichung des gesellschaftlichen Irrsinns gegen den Menschen. Diejenigen, die zu anderen Zeiten die größten Antisemiten hätten werden können, weil sie in der Entwicklung des gesellschaftlichen Prozesses eine Versündigung gegen die Natur, die Ordnung, das Alte sahen, haben sich heute längst damit ausgesöhnt. Sie wollen am Zustand der Welt, wie sie sich entwickelt hat, festhalten, trotz aller Grausamkeit, die damit zusammenhängt, weil im Zentrum ausufernder Grausamkeit in der Welt, ein ruhiger Ort entsanden war, der nun dabei ist, zu verfallen. Antisemit ist ein Gebrauchsschmähwort dieser Leute, und sie meinen damit jene, die im Sog der gewalttätigen Eruption der alten Ordnung begonnen haben, sich mit dieser Eruption zu identifizieren. Die darin einen Fortschritt sehen. Und dies sind die Antizionisten. Antizionisten sehnen den Untergang der alten Ordnung herbei. Sie identifizieren sich nicht mit dieser Ordnung, sondern mit der Gewalt gegen diese Ordnung. Deswegen erscheint ihnen der Angriff der Hamas als Befreiung. Nicht weil Juden dort niedergemetzelt wurden, sondern weil der Kampf gegen die Aufrechterhalter des Alten, des vergehenden gesellschaftlichen Zwangs begonnen hat. Dass mit ihnen keine bessere, sondern eine noch schlimmere neue Ordnung aufzieht, sehen sie nicht. Und das ist es, was sie gefährlich macht, nicht die Frage, ob sie Juden hassen oder nicht.
Zionist ist das Wort geworden für Vertreter der westlichen bürgerlichen Gesellschaft, für Menschen, die diese erhalten wollen; die sie erhalten wollen trotz all des Elends, des Zwangs, der Gewalt, die von ihr ausgeht. Und Antizionist ist das Wort geworden für die Menschen, die dagegen aufbegehren, auf welche Weise auch immer. Und dabei ist es egal, ob man diesen Titel für sich haben will oder nicht. Die Reihenfolge ist aber diese: Erst bekommt man ihn, dann bekommt man es.
Wir Gedenken heute der Opfer der Schoah und ihrem praktischen Auftakt, dem Novemberpogrom. Und ein solches Gedenken braucht keinen Zweck; es genügt sich in seiner traurigen Zwecklosigkeit. Immer wieder wird dieses Gedenken mit Zweck aufgefüllt, mit Sinn: in pastoralen Reden wird so getan, als hätten wir aus der Zeit, deren Dimension des Schreckens sich wohl niemals ganz enthüllen wird, unsere Lehren gezogen oder sie zu ziehen. Wir zeigen uns selbst, zeigen uns als Geläuterte, als Gefestigte, als Gebildete. Aber es ist andersherum: Die Zeit und das Morden, an das wir erinnern, zeigt uns etwas: Dass die Menschen den Titel, unter dem sie ermordet werden, zuvor von ihren Mördern bekommen.