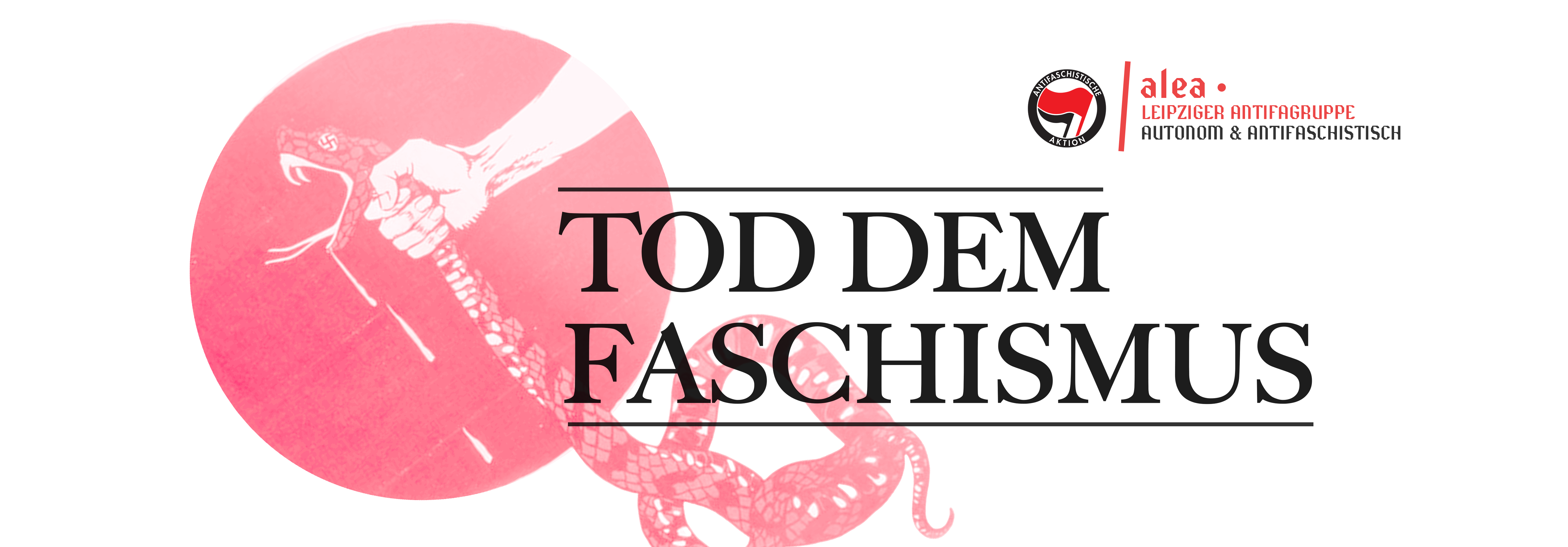Wandel des Faschismus und Form antifaschistischer Organisierung
Redebeitrag gehalten von einem Genossen der translib am 25. Mai 2025 auf der Kundgebung Re:organsiert die Antifaschistische Aktion
Wir haben uns heute hier versammelt aus Anlass des Jahrestages eines Angriffs von Faschisten.
Faschistische Gewalt – Zerstörung und Mord – gab es vorher. Es gab sie nachher. Und es gibt sie heute. Jedem einzelnen Akt faschistischer Gewalt müsste gedacht werden. Jeder dieser Akte fordert es. Denn diese Taten mahnen uns, dass die Verhältnisse der Menschen immer noch keine menschlichen Verhältnisse sind. – Was diesen Angriff von anderen unterscheidet, ist die politische Reaktion, die er hervorrief. Vorher prägten Diffamierung, Spott und Kritik das Verhältnis von Kommunisten und Sozialdemokraten. Bis dahin, dass man im Gegenüber den politischen Feind ausmachte – und nicht in den zahlreicher werdenden faschistischen Horden und der immer stärker werdenden NSDAP. Doch nach dem Angriff deutscher Faschisten auf Parlamentarier der KPD und der SPD am 25. Mai 1932 gründete die KPD die Antifaschistische Aktion. Es war an der Zeit, sich gemeinsam gegen den deutschen Faschismus zu wehren und Widerstand gegen ihn zu leisten, anstatt sich weiter gegenseitig zu bekämpfen. Dieser Impuls einer gemeinsamen Antifaschistischen Aktion war nicht ausreichend, wie wir wissen. Trotzdem enthält er einen wahren Kern: Den Faschismus besiegen wir nicht getrennt, sondern nur gemeinsam.
Der Faschismus in seinen verschiedenen Formen ist das Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse. Er wandelt sich ebenso wie die gesellschaftliche Formation, der er entspringt. Die gegenwärtigen faschistischen Tendenzen haben deshalb einen anderen Charakter als die von 1932. Ein besonderer Wandel der letzten Jahre besteht darin, dass die Autoritären auf den Straßen und im Parlament Freiheit als Schlagwort für sich entdeckt haben.
Teile des historischen Faschismus haben sich immer auch als Befreiungsbewegung verstanden. Die »Befreiung des deutschen Volkes« oder die »Befreiung von der jüdischen Weltherrschaft« waren etwa zentral für den Nationalsozialismus. Aber der moderne Begriff bürgerlicher Freiheit war Teil der Feindbestimmung. Die Französische Revolution wurde zum Sündenfall der Moderne erklärt. Der politische Liberalismus, dem die bürgerliche Freiheit als Leitgedanke diente, und die sozialistische Tradition, welche die politische Freiheit um die soziale Gleichheit ergänzte, konnten so auf derselben Grundlage als moderne Entartung geschmäht werden. Den ideologischen Traditionalismus und die Kritik moderner Rechtsstaatlichkeit hatten die deutschen Faschisten in den 1920er Jahren nicht zuletzt mit den Konservativen ebenso gemein wie die Heroisierung der Männlichkeit und die Glorifizierung des Krieges. Deutlich wird das auch in der geteilten Tugendlehre: Disziplin, Gehorsam und Loyalität.
Der historische Hintergrund dieser Gemeinsamkeit bilden nicht zuletzt das deutsche Kaiserreich und der erste Weltkrieg. Diese historische Erfahrung ist die Grundlage faschistischer Subjektivität, die sich wesentlich durch soldatische Disziplin, hierarchischen Untertanenstolz und autoritäre Härte auszeichnete.
Diese autoritäre Formierung steht allerdings in schrillem Kontrast dazu, dass Freiheit heute Kampfbegriff der Rechten ist. Nicht erst seit der Pandemie sind die Forderungen nach Freiheit bei Demonstrationen und Kundgebungen immer lauter zu hören. Sogar die bürgerliche Maxime der Aufklärung, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, taugt als Referenz. Diese faschistoiden Haufen verstehen sich eher als Rebellen, die sich gegen den Staat auflehnen, denn als gefügige Untertanen, die bruchlos in ihm aufgehen.
Zweifellos macht das gegenwärtig nur einen Teil der faschistischen Kräfte aus. Den altbekannten völkischen Faschismus mit seinen disziplinierten Braunhemden gibt es ebenso noch wie jugendliche Neonazi-Banden, die Asylunterkünfte und Jugendzentren terrorisieren.
Auch hier wird eine »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« im Faschismus offenbar. Denn dass der Faschismus heute die Freiheit des Einzelnen fordert und sich als die einzige politische Kraft für deren Verteidigung geriert, ist ebenso zynisch wie es widersprüchlich scheint. Freie Autoritäre – das scheint schlicht irrational. Ohne Zweifel ist es das letztlich auch, doch der Faschismus hat auch historisch immer wieder Widersprüche ausgehalten: er war ebenso konservativ traditionsbewahrend wie futuristisch zukunftsorientiert und ebenso naturverbunden wie technikaffin. All diesen Widersprüchen lag letztlich immer etwas zugrunde, das es erlaubte, sie als ideologische Versatzstücke zu integrieren. So auch bei dem von Freiheit und Autorität.
Denn welche Freiheit beschwört man denn? Eine Freiheit, die bedeutet, ungestört tun und lassen zu können, was man will, weil man es selbst am besten weiß. Eine Freiheit, die sich in Eigentum manifestiert, das es vor staatlichen Eingriffen zu schützen gilt. Eine Freiheit, die sich lauthals Geltung verschafft und sich dabei keinerlei Vorschriften darüber machen lässt, was gesagt wird und wie es gesagt wird.
Dass Freiheit faschistisch werden konnte, scheint zwar ein Widerspruch. Es ist aber lediglich ein Ausdruck der gegenwärtigen gesellschaftlichen Formation. Denn die Freiheit der Autoritären und Faschisten entspringt der bürgerlichen Freiheit. Es ist die ökonomische Freiheit des liberalen Bürgers, der die absolute Verfügungsgewalt über sein Eigentum hat. Es ist die Freiheit des unabhängigen Gesellschaftsatoms, das mit anderen nur insofern zu tun hat, als sie etwas haben oder es etwas von ihnen will. Es ist die unsoziale Freiheit, die den eigenen Vorteil auf Kosten aller anderen will. Es ist die Freiheit der Willkür, die vom Staat solange nichts wissen will, wie er gegen sie ist.
Doch insgeheim wäre sie nur allzu bereit sich mit dem Staat gleichzumachen, wenn er nur dasselbe wollte. Denn diese Form libertärer Freiheitsliebe wartet nur darauf, sich der richtigen Autorität unterzuordnen. Dann schlägt die Lust an der Rebellion um in die an der kollektiven Unterordnung unter die Autorität, in die man doch nur die eigene Herrschlust projiziert. Denn die Lust an der libertären Rebellion speist sich aus der Imagination absoluter Verfügung, die sie im totalitären Staat verwirklicht findet. Sie ist die Vorfreude des Stammtisches darauf, dass doch endlich einmal alles so gemacht wird, wie man es schon immer gesagt hat. Die wahnhafte Allmachtsphantasie, die sich faschistische Bahn schlägt, entspringt der absoluten Verfügungsgewalt des liberalen Eigentümers.
Dass diese faschistische Freiheit Ausdruck der liberalen Bürgerlichkeit der Ökonomie ist, erklärt, weshalb es sie heute so attraktiv macht. Denn unsere historische Erfahrung ist nicht soldatische Härte, preußische Disziplin oder kollektive Unterordnung. Es ist eher die einer gesellschaftlichen Atomisierung, des Staatsrückbaus und der Eigenverantwortung. Nach Jahrzehnten der Zertrümmerung sozialer Strukturen kann es nicht verwundern, dass der Faschismus heute zunächst als individuelle Rebellion auftritt. Ungehindert wird er diese Maske allerdings schnell fallenlassen und sich offen zu erkennen geben.
Auch wenn der Faschismus heute ein anderer ist als 1932, es bleibt die Notwendigkeit, gemeinsam gegen ihn Widerstand zu leisten. Der Zweck der Antifaschistischen Aktion war vor allem das: Die Organisation eines praktischen Antifaschismus. Um der faschistischen Gewalt etwas entgegenzusetzen, sollten überall Selbstschutzeinheiten gebildet werden. Doch auch wenn Antifaschismus gegen die faschistische Gewalt gerichtet ist, besteht er nicht in roher Gegengewalt. Zweifellos bedarf es der Verteidigung vor faschistischer Gewalt. Doch das allein reicht nicht aus. Denn es ist das Ganze dieser Gesellschaft, welche das faschistische Potenzial in sich birgt. Deshalb bedarf es für das theoretische Begreifen wie die praktische Kritik des Faschismus einer Perspektive auf die gesellschaftliche Totalität.
Einzelne Akte gegen faschistische Gewalt sind deshalb bestenfalls Symptombekämpfung. Schlimmstenfalls verwechseln sie das Individuelle mit dem Gesellschaftlichen und glauben der Kampf gegen den Faschismus sei auf den Kampf gegen Faschisten reduzierbar. Er ist es nicht. Wenn Faschismus ein gesellschaftliches Phänomen ist, braucht es gesellschaftliche Veränderung. Wenn er ein Phänomen ist, dass den gesellschaftlichen Grundprinzipien entspringt, braucht es eine grundsätzliche Veränderung. Denn nur dann kann der Kampf gegen den Faschismus erfolgreich sein. Konsequenter Antifaschismus ist ohne Perspektive auf eine grundsätzliche Veränderung dieser Gesellschaft nicht möglich.
Eine solche Veränderung kann nur eine gesellschaftliche Kraft leisten. Der Antifaschismus muss also eine solche gesellschaftliche Kraft werden. Denn momentan ist er es nicht. Antifaschistisch für eine gesellschaftliche Veränderung einzustehen, bedeutet dann Menschen zu überzeugen, selbst gegen den Faschismus einzutreten. »Her zu uns!« ist keine Floskel. Es ist kein agitatorisches Ornament der Antifaschistischen Aktion. Es ist vielmehr wesentlich für den Antifaschismus.
Aber die bloße Menge macht keine gesellschaftliche Kraft aus. Dafür ist Organisierung notwendig. Ohne eine Form der Organisation können sich die individuellen Kräfte weder bündeln noch koordinieren.
Doch es wäre irreführend Organisation lediglich als ein Bündeln bereits vorhandener Kräfte zu verstehen. Denn die Organisation bildet diese Kräfte überhaupt erst. Ganz konkret, indem es Aufklärungs- und Bildungsarbeit benötigt, um Menschen zu überzeugen. Eine Arbeit, die genauso organisiert werden muss wie der aktive Selbstschutz.
Doch es ist nicht nur der Schutz vor Faschisten, sondern der vor dem Faschismus. Denn die gesellschaftlichen Dynamiken, denen der Faschismus entspringt, müssen nicht nur theoretisch aufgeklärt werden, um daraufhin antifaschistische Erinnerungs- und Bildungsarbeit zu leisten. Der praktischen Wirkung der ihm zugrundeliegenden gesellschaftlichen Dynamiken muss auch individuell immer wieder Einhalt geboten werden. Denn die gesellschaftlichen Gründe faschistischer Tendenzen zu erkennen, feit uns nicht vor ihrer Wirkung. Auch wir sind Teil dieser gesellschaftlichen Formation. Die gesellschaftliche Atomisierung macht auch vor denen nicht halt, die sie kritisieren. Auch sie sind der bürgerlichen Kälte nicht nur ausgesetzt. Sie sind auch Teil von ihr. Vereinzeln wir uns, drohen wir diesen Dynamiken schutzlos zu erliegen. Denn nicht nur, dass die nötige Selbstbildung und Selbstaufklärung nur gemeinsam möglich sind. Das Gemeinsame erlaubt uns auch, gegen die Vereinzelung Beziehungen aufzubauen, sodass wir der bürgerlichen Kälte mit solidarischer Wärme widerstehen.
Sich zu organisieren, ist demnach weder ein Selbstzweck noch bedeutet es eine individuelle Unterordnung. Sicher, es bedarf einer gewissen Koordination, um gesellschaftlich wirksam zu werden. Das beinhaltet, individuelle Handlungen an einem gemeinsamen Ziel auszurichten.
Es kann aber nicht bedeuten, sich dem Kollektiv reibungslos einzufügen. Diese soldatengleiche Unterordnung stellt doch vielmehr einen Teil des Autoritären dar, den es am Faschismus zu bekämpfen gilt. Wie soll das gelingen, wenn man ihn strukturell widerspiegelt?
Dass die Organisierung das politische Mittel ist, um gegen das Schlechte zu kämpfen, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie auch der Ort ist, an dem für das Bessere gerungen wird. Denn die »Zerschmetterung des Nazismus« und der »Aufbau einer neuen Welt« sind dasselbe. Sich eingedenk dessen zu organisieren, heißt, im Wissen um die Unmöglichkeit des Richtigen im Falschen für das Bessere einzustehen. Das muss auch bedeuten, gemeinsam den Widerspruch auszuhalten, dass selbst der Widerstand gegen das Falsche sich nicht von ihm frei machen kann. Im Gegenteil, er kann sich sogar an das Falsche angleichen. Denn: »Der Haß gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge«. Sich antifaschistisch zu organisieren, schließt also auch den kollektiven Versuch ein, diesen Verhärtungstendenzen etwas entgegenzusetzen, um sich nicht dem anzugleichen, wogegen man kämpft. Eine Organisation, die selbst autoritäre Züge hat, wird daran scheitern.
Heute scheint die Lage offen zu Tage zu liegen: »Die Kräfte sind gering« und »das Ziel liegt in großer Ferne«. Doch es ist an uns zu zeigen: So muss es nicht bleiben! Denn trotz allem besteht die Möglichkeit, diesen »finsteren Zeiten« zu entrinnen. Lasst uns für diese Möglichkeit gemeinsam einstehen!